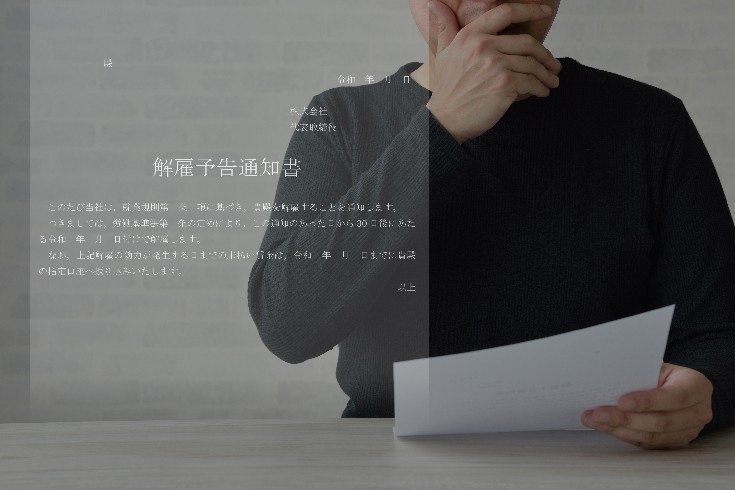Urheberpersönlichkeitsrechte im japanischen Urheberrecht: Rechtliche Risiken und Maßnahmen, die Unternehmen kennen sollten

Unter japanischem Recht (日本の法律の下では) weisen die aus kreativer Tätigkeit entstehenden Rechte zwei unterschiedliche Charakteristika auf. Eines davon ist das ‘Urheberrecht (Vermögensrecht)’, ein wirtschaftliches Recht, das lizenziert oder übertragen werden kann. Dies ist ein international anerkanntes Konzept. Doch es gibt noch ein weiteres, fundamentales Recht im Kern des japanischen Urheberrechtssystems: das ‘Urheberpersönlichkeitsrecht’. Dieses Recht schützt die persönliche und geistige Verbindung, die ein Urheber zu seinem Werk hat, und wird unter dem japanischen Urheberrechtsgesetz als ein nicht übertragbares, ausschließlich persönliches Recht betrachtet. Gerade diese Nichtübertragbarkeit kann einzigartige und erhebliche rechtliche Risiken im Unternehmenskontext hervorrufen. Selbst wenn ein Unternehmen annimmt, es habe durch Vertrag das Urheberrecht vollständig erworben, behält die urhebernde Person das Urheberpersönlichkeitsrecht. Infolgedessen kann es vorkommen, dass der Urheber später Einwände gegen Änderungen oder Nutzungsweisen des Werks erhebt und rechtliche Schritte wie Unterlassungs- oder Schadensersatzansprüche einleitet. Dieser Artikel wird zunächst das grundlegende Konzept des Urheberpersönlichkeitsrechts im Vergleich zum Urheberrecht (Vermögensrecht) klären. Anschließend werden die drei Hauptrechte, die das Urheberpersönlichkeitsrecht bilden – nämlich das ‘Veröffentlichungsrecht’, das ‘Recht auf Namensnennung’ und das ‘Recht auf Werksintegrität’ – unter Einbeziehung japanischer Gerichtsfälle konkret erläutert. Abschließend wird das ‘Diensturheberrecht’ als das effektivste rechtliche Rahmenwerk für Unternehmen zur systematischen Verwaltung dieser Risiken detailliert beschrieben und praktische Richtlinien aufgezeigt.
Die Grundkonzepte des Urheberpersönlichkeitsrechts: Unterschiede zum Urheberrecht als Eigentumsrecht
In Japan wird das Urheberrecht durch das japanische Urheberrechtsgesetz in zwei große Kategorien unterteilt. Die eine ist das ‘Urheberrecht (Eigentumsrecht)’, das den wirtschaftlichen Wert eines Werkes schützt, und die andere ist das ‘Urheberpersönlichkeitsrecht’, das die geistigen Interessen des Urhebers, also die persönliche Verbindung zwischen dem Schöpfer und seinem Werk, schützt. Artikel 17 Absatz 1 des japanischen Urheberrechtsgesetzes legt fest, dass der Urheber beide Rechte besitzt.
Das hervorstechendste Merkmal des Urheberpersönlichkeitsrechts ist seine Unübertragbarkeit. Artikel 59 des japanischen Urheberrechtsgesetzes bestimmt klar, dass das Urheberpersönlichkeitsrecht ausschließlich dem Urheber gehört und nicht übertragen werden kann. Dies bedeutet, dass das Urheberpersönlichkeitsrecht untrennbar mit der Persönlichkeit des Urhebers verbunden ist und, selbst wenn das Urheberrecht (Eigentumsrecht) durch einen Vertrag auf eine andere Partei übergeht, das Urheberpersönlichkeitsrecht dauerhaft beim ursprünglichen Schöpfer verbleibt. Diese rechtliche Eigenschaft ist von äußerster Wichtigkeit in der Vertragspraxis bei der Lizenzierung und Übertragung von Nutzungsrechten. Ein Vertrag, der lediglich die Übertragung des Urheberrechts beinhaltet, reicht nicht aus, um die mit dem Urheberpersönlichkeitsrecht verbundenen Risiken zu managen. Für Unternehmen, die ein Werk frei und flexibel nutzen möchten, ist es unerlässlich, neben dem Erwerb des Urheberrechts (Eigentumsrecht) auch angemessene Vorkehrungen für das Urheberpersönlichkeitsrecht zu treffen.
Die folgende Tabelle fasst die grundlegenden Unterschiede zwischen diesen beiden Rechten zusammen.
| Merkmale | Urheberrecht (Eigentumsrecht) | Urheberpersönlichkeitsrecht |
| Hauptzweck | Schutz wirtschaftlicher und vermögensrechtlicher Interessen | Schutz der persönlichen und geistigen Interessen des Schöpfers |
| Übertragbarkeit | Übertragung und Lizenzierung durch Vertrag möglich | Nach Artikel 59 des japanischen Urheberrechtsgesetzes nicht übertragbar (ausschließlich persönlich) |
| Rechtliche Grundlage | Artikel 21 bis 28 des japanischen Urheberrechtsgesetzes | Artikel 18 bis 20 des japanischen Urheberrechtsgesetzes |
| Hauptstrategie für Unternehmen | Erwerb, Übertragung oder Lizenzierung durch Vertrag | Anwendung des Systems der ‘Dienstwerke’ oder vertragliche Vereinbarung über die Nichtausübung der Rechte |
Das Recht auf Veröffentlichung: Die Kontrolle über unveröffentlichte Werke nach japanischem Urheberrecht
Das Recht auf Veröffentlichung ist in Artikel 18 des japanischen Urheberrechtsgesetzes festgelegt und besagt, dass “der Urheber das exklusive Recht hat, sein noch nicht veröffentlichtes Werk der Öffentlichkeit zugänglich zu machen oder zu präsentieren”. Dies ist das ausschließliche Recht des Urhebers, zu entscheiden, wann und in welcher Form sein Werk veröffentlicht wird. In der Unternehmenspraxis gibt es viele unveröffentlichte Werke, wie Entwürfe von Geschäftsplänen, unveröffentlichte Forschungs- und Entwicklungsberichte, Software vor der Veröffentlichung und Werbedesigns vor der endgültigen Entscheidung, die innerhalb eines Unternehmens erstellt werden. Diese Werke ohne die Zustimmung des Urhebers, sei es ein Angestellter oder ein externer Auftragnehmer, zu veröffentlichen, kann eine Verletzung des Veröffentlichungsrechts darstellen.
Das japanische Urheberrechtsgesetz sieht jedoch unter bestimmten Umständen eine gesetzliche “Vermutung” der Zustimmung des Urhebers vor. Gemäß Artikel 18 Absatz 2 Nummer 1 des japanischen Urheberrechtsgesetzes wird angenommen, dass der Urheber seine Zustimmung erteilt hat, wenn die Urheberrechte (Vermögensrechte) an einem unveröffentlichten Werk übertragen wurden und der Erwerber diese Rechte ausübt, indem er das Werk der Öffentlichkeit zugänglich macht oder präsentiert. Diese Bestimmung zielt darauf ab, die reibungslose Nutzung von Rechten an unveröffentlichten Werken zu erleichtern, die durch Verträge von Unternehmen erworben wurden. Es ist jedoch zu beachten, dass diese “Vermutung” rechtlich widerlegt werden kann. Die rechtliche Wirkung der “Vermutung” ist schwächer als die des “Feststellens”, und wenn der Urheber nachweisen kann, dass er zwar die Urheberrechte übertragen, aber der Veröffentlichung nicht zugestimmt hat, kann die Vermutung aufgehoben werden. Daher ist es für Unternehmen, die unveröffentlichte Werke erwerben und planen, diese in Zukunft zu veröffentlichen, ratsam, sich nicht allein auf diese Vermutungsregelung zu verlassen, sondern im Vertrag eine klare und unwiderrufliche Zustimmung des Urhebers zur Veröffentlichung hinsichtlich des Zeitpunkts und der Methode zu erhalten, um Streitigkeiten im Vorfeld zu vermeiden.
Das Recht auf Namensnennung: Die Bestimmung des Urheberkredits unter japanischem Urheberrecht
Das Recht auf Namensnennung ist in Artikel 19 des japanischen Urheberrechtsgesetzes festgelegt. Dieses Recht sichert Urhebern die Wahl zu, ob sie ihren echten Namen, ein Pseudonym oder gar keinen Namen (anonym) bei der Veröffentlichung ihrer Werke als Urhebername anzeigen möchten. Nutzer des Werkes sind grundsätzlich verpflichtet, der vom Urheber gewählten Art der Namensnennung zu folgen.
Es gibt jedoch Ausnahmen von diesem Recht. Absatz 3 des Artikels 19 des japanischen Urheberrechtsgesetzes besagt, dass die Namensnennung weggelassen werden kann, “wenn es nach dem Zweck und der Art der Nutzung des Werkes als angemessen erachtet wird, dass kein Interesse des Urhebers verletzt wird, als Schöpfer des Werkes anerkannt zu werden, solange dies nicht gegen faire Gepflogenheiten verstößt”. Ein allgemeines Beispiel hierfür ist, dass in Restaurants oder Geschäften die Namen der Komponisten nicht bei jedem Musikstück angekündigt werden müssen, wenn Musik als Hintergrundmusik gespielt wird.
Die technologische Entwicklung der letzten Jahre stellt neue Herausforderungen an das Recht auf Namensnennung. Ein symbolträchtiges Beispiel hierfür ist das Urteil des Obersten Gerichtshofs von Japan vom 21. Juli 2020 (im Volksmund “Retweet-Fall” genannt). In diesem Fall hatte ein Fotograf ein Foto, auf dem sein Name angezeigt wurde, auf Twitter gepostet, und dieses wurde von einer dritten Partei retweetet. Dabei wurde das Bild aufgrund der Spezifikationen des Twitter-Systems automatisch zugeschnitten, sodass der Namensbereich des Fotos im Timeline-Display verschwand. Der Oberste Gerichtshof stellte fest, dass selbst wenn der Retweeter nicht die Absicht hatte, den Namen zu entfernen, die Tatsache, dass das Foto ohne Namensnennung der Öffentlichkeit präsentiert wurde, eine Verletzung des Rechts auf Namensnennung des Fotografen darstellt. Dieses Urteil gibt Unternehmen, die Websites betreiben, Anwendungen entwickeln oder Social-Media-Marketing betreiben, wichtige Hinweise. Es zeigt, dass bereits in der Designphase von Systemen, die Inhalte automatisch verarbeiten und anzeigen, darauf geachtet werden muss, dass die Urheberkredite nicht unbeabsichtigt gelöscht werden. Es ist unerlässlich zu erkennen, dass eine Verletzung des Rechts auf Namensnennung nicht nur durch direkte menschliche Handlungen, sondern auch durch automatische Systemfunktionen entstehen kann.
Das Recht auf Wahrung der Werkintegrität: Schutz der Vollständigkeit von Werken unter japanischem Urheberrecht
Das Recht auf Wahrung der Werkintegrität ist eines der stärksten Persönlichkeitsrechte eines Urhebers und in der Geschäftspraxis häufig Ursache für Streitigkeiten. Artikel 20 Absatz 1 des japanischen Urheberrechtsgesetzes besagt, dass der Urheber das Recht hat, die Integrität seines Werkes und dessen Titel zu bewahren und dass Änderungen, Entfernungen oder sonstige Modifikationen gegen seinen Willen nicht vorgenommen werden dürfen. Dieses Recht schützt den Urheber davor, dass der Inhalt oder Titel seines Werkes ohne seine Zustimmung willkürlich verändert wird. Beispielsweise könnten das Ändern der Handlung eines Romans, das Anpassen der Farbgebung einer Illustration oder das Entfernen eines Teils eines Logo-Designs allesamt eine Verletzung des Rechts auf Wahrung der Werkintegrität darstellen.
Natürlich sind nicht alle Änderungen verboten. Artikel 20 Absatz 2 des japanischen Urheberrechtsgesetzes listet einige Ausnahmen auf, bei denen das Recht auf Wahrung der Werkintegrität nicht greift. Von besonderer Relevanz für die Unternehmenspraxis ist Nummer 4, die Änderungen erlaubt, die “aufgrund der Natur des Werkes und des Zwecks sowie der Art seiner Verwendung als unvermeidlich angesehen werden”. Die Beurteilung, ob eine Änderung “unvermeidlich” ist, bleibt jedoch äußerst vage und rechtlich schwer vorhersehbar. Selbst Handlungen, die im Geschäftsleben als selbstverständlich angesehen werden, wie das Ändern der Bildgröße für eine Website oder das Kürzen eines Textes zur Erstellung einer Zusammenfassung, können zu Konflikten führen, wenn der Urheber behauptet, dass seine kreativen Absichten beeinträchtigt wurden.
Entscheidend ist hier, dass das Kriterium “gegen den Willen” nicht nur auf den subjektiven Gefühlen des Urhebers basiert, sondern auch nach objektiven Maßstäben beurteilt wird. Da jedoch die Grenze zwischen objektiver Beurteilung und “unvermeidlichen Änderungen” unklar ist, kann dieses Recht zu einem mächtigen Verhandlungsinstrument für den Schöpfer werden. Unternehmen können gezwungen sein, sich auf nachteilige Vergleiche einzulassen, um das Risiko von Rechtsstreitigkeiten über geringfügige Änderungen zu vermeiden. Um solche Unsicherheiten zu beseitigen, ist es äußerst wirksam, bei Vertragsabschlüssen über die Nutzung von Werken die erwarteten Änderungen (wie Größenänderung, Zuschneiden, Farbkorrektur usw.) konkret aufzulisten und Klauseln einzuführen, die besagen, dass der Urheber diesen Änderungen im Voraus umfassend zustimmt.
Präzedenzfälle zum Recht auf Wahrung der Werkintegrität nach japanischem Recht
Um die Interpretation und den Anwendungsbereich des Rechts auf Wahrung der Werkintegrität zu verstehen, stellen wir zwei wichtige Präzedenzfälle vor.
Der erste Fall ist das Urteil des Obersten Gerichtshofs von Japan vom 13. Februar 2001 (Heisei 13) (bekannt als der “Tokimeki Memorial-Fall”). In diesem Fall wurde ein Händler verklagt, der Speicherkarten verkaufte, mit denen man die Parameter des beliebten Liebessimulationsspiels “Tokimeki Memorial” unrechtmäßig ändern konnte. Der Beklagte (der Händler) behauptete, dass er das Spielprogramm selbst nicht direkt verändert habe. Der Oberste Gerichtshof stellte jedoch fest, dass durch die Verwendung der vom Beklagten verkauften Speicherkarten die Parameter der Hauptfigur des Spiels auf Werte geändert wurden, die normalerweise nicht möglich wären, und dass dadurch die Entwicklung der Spielgeschichte und die Darstellung der Charaktere in einer Weise verändert wurden, die über die vom Urheber beabsichtigte Reichweite hinausging. Das Gericht entschied, dass der Verkauf von Geräten, die eine solche Veränderung erleichtern, an sich eine rechtswidrige Handlung darstellt, die die Verletzung des Rechts des Urhebers auf Wahrung der Werkintegrität fördert. Dieses Urteil zeigt, dass nicht nur die direkte Veränderung eines Werkes, sondern auch das Bereitstellen von Werkzeugen oder Dienstleistungen, die Dritten solche Veränderungen ermöglichen, eine Verletzung des Rechts auf Wahrung der Werkintegrität (indirekte Verletzung) darstellen kann, was insbesondere für die Software- und Digitalinhalteindustrie ein wichtiger Präzedenzfall ist.
Der zweite Fall ist das Urteil des Bezirksgerichts Tokio vom 26. März 1999 (Heisei 11) (bekannt als der “Delfinfoto-Fall”). In diesem Fall hatte ein Verlag Fotos von Walen und Delfinen, die von einem Fotografen aufgenommen wurden, in einer Zeitschrift veröffentlicht, ohne vorherige Genehmigung des Fotografen zu erhalten, und die Fotos zugeschnitten (Teile von oben, unten, links und rechts entfernt) sowie Text über die Fotos gelegt, um sie in das Layout einzufügen. Der Verlag behauptete, dass dies aus Gründen des Zeitschriftenlayouts notwendig war und das Wesen des Werkes nicht beeinträchtigte. Das Gericht stellte jedoch fest, dass durch das Zuschneiden die ursprüngliche Komposition der Fotos verändert wurde und dies nicht der kreativen Absicht des Urhebers entsprach. Auch das Überlagern von Text auf den Fotos wurde als eine Art Entfernungshandlung angesehen, die Teile des Fotos verdeckt, und das Gericht entschied, dass beide Handlungen das Recht des Fotografen auf Wahrung der Werkintegrität verletzten. Dieses Urteil macht deutlich, dass selbst wenn es aus Design- oder technischen Gründen notwendig ist, eine Veränderung, die die kreative Ausdrucksweise des Urhebers beeinflusst, eine Verletzung des Rechts auf Wahrung der Werkintegrität darstellen kann, was insbesondere für die Bereiche Werbung, Verlagswesen und Webdesign von Bedeutung ist.
Dienstliche Urheberschaft: Der rechtliche Rahmen in Japan für die Anerkennung von Körperschaften als Urheber
Wie wir bisher gesehen haben, sind Urheberpersönlichkeitsrechte unübertragbar und beinhalten ein schwer zu managendes Risiko für Unternehmen. Um dieses grundlegende Problem zu lösen, bietet das japanische Urheberrechtsgesetz in Artikel 15 (Heisei 37 (2023)) die umfassendste und stärkste rechtliche Maßnahme: das System der dienstlichen Urheberschaft.
Das herausragendste Merkmal des Systems der dienstlichen Urheberschaft ist, dass unter bestimmten Voraussetzungen nicht der tatsächliche Schöpfer des Werks, also der individuelle Angestellte, sondern der Arbeitgeber oder die Körperschaft als “Urheber” von Beginn der Schöpfung an anerkannt wird. Dadurch erwirbt die Körperschaft nicht nur das Urheberrecht (Vermögensrecht), sondern auch originär das Urheberpersönlichkeitsrecht. Dies führt dazu, dass beim individuellen Schöpfer keine Urheberpersönlichkeitsrechte entstehen und somit das Risiko, das aus der Unübertragbarkeit resultiert, vollständig eliminiert wird. Dieses System ist eine wichtige Ausnahme von dem Grundsatz des japanischen Urheberrechts, dass der Schöpfer als Urheber gilt (Schöpferprinzip), und wurde eingerichtet, um die reibungslose Geschäftstätigkeit von Unternehmen zu unterstützen. Da es sich jedoch um eine Ausnahmevorschrift handelt, neigen Gerichte dazu, die Voraussetzungen für deren Anwendung streng auszulegen. Um von diesem System profitieren zu können, müssen Unternehmen sicherstellen, dass sie alle festgelegten Anforderungen erfüllen und entsprechende Beweise sorgfältig dokumentieren.
Voraussetzungen für die Entstehung von Diensterfindungen und praktische Hinweise in Japan
Damit eine Diensterfindung in Japan entsteht, müssen alle folgenden Voraussetzungen des japanischen Urheberrechtsgesetzes Artikel 15 erfüllt sein:
- Die Erfindung muss auf Initiative einer juristischen Person oder eines anderen Arbeitgebers (im Folgenden “Unternehmen etc.”) erstellt werden.
- Sie muss von einer Person erstellt werden, die im Rahmen der Geschäftstätigkeit des Unternehmens etc. tätig ist.
- Die Erstellung muss im Rahmen der dienstlichen Aufgaben erfolgen.
- Das Unternehmen etc. muss die Erfindung unter seinem eigenen Namen veröffentlichen. (Für Computerprogramme ist diese Voraussetzung jedoch nicht erforderlich.)
- Zum Zeitpunkt der Erstellung darf es keine besonderen Bestimmungen in Verträgen, Arbeitsordnungen oder anderen Regelungen geben.
Unter diesen Voraussetzungen ist der Umfang der “Personen, die im Rahmen der Geschäftstätigkeit tätig sind”, in der Praxis am schwierigsten zu interpretieren. Es ist offensichtlich, dass Festangestellte diese Voraussetzung erfüllen, aber bei Werken, die von externen Auftragnehmern oder Freiberuflern erstellt wurden, wird die Beurteilung komplizierter.
In diesem Zusammenhang hat das japanische Oberste Gericht in seinem Urteil vom 11. April 2003 (bekannt als “RGB-Fall”) wichtige Beurteilungskriterien aufgestellt. Das Oberste Gericht entschied, dass die Frage, ob jemand als “im Rahmen der Geschäftstätigkeit tätig” gilt, nicht anhand formaler Kriterien wie der Bezeichnung des Vertrags (zum Beispiel “Werkvertrag”) beurteilt werden sollte, sondern vielmehr darauf, ob zwischen dem Arbeitgeber und dem Schöpfer eine substantielle Weisungs- und Kontrollbeziehung besteht und ob das gezahlte Geld als Gegenleistung für die erbrachte Arbeit angesehen werden kann. Dies sollte auf der Grundlage konkreter Umstände wie der Art der Arbeit, dem Vorhandensein oder Fehlen von Weisungen und Kontrolle sowie der Höhe und Art der Zahlung der Vergütung substantiell beurteilt werden.
Was dieses Urteil zeigt, ist die Tatsache, dass Unternehmen nicht leichtfertig davon ausgehen können, dass eine Diensterfindung bei der Zusammenarbeit mit externen Experten entsteht. Freiberufliche Designer oder Programmierer stehen in der Regel nicht unter der direkten Weisung und Kontrolle eines Unternehmens und führen ihre Arbeit als unabhängige Geschäftsleute durch, so dass sie wahrscheinlich nicht als “im Rahmen der Geschäftstätigkeit tätig” anerkannt werden. Daher müssen Unternehmen eine duale Strategie für das Management ihres geistigen Eigentums verfolgen. Für Werke, die von Mitarbeitern geschaffen werden, sichern sie die Rechte durch die Ausarbeitung von Arbeitsverträgen und Arbeitsordnungen, um sicherzustellen, dass die Voraussetzungen für eine Diensterfindung erfüllt sind. Andererseits sollten sie bei Werken, die von externen Dienstleistern geschaffen werden, nicht auf die Entstehung einer Diensterfindung vertrauen, sondern in Verträgen eine klare Übertragung der Urheberrechte (Vermögensrechte) festlegen und eine Sondervereinbarung treffen, dass die Urheberpersönlichkeitsrechte nicht ausgeübt werden (Nichtausübungsvereinbarung), was die einzige sichere Risikomanagementstrategie darstellt.
Zusammenfassung
Die Urheberpersönlichkeitsrechte nach dem japanischen Urheberrechtsgesetz sind nicht übertragbar und stellen starke Rechte dar, um die persönlichen Interessen der Urheber zu schützen. Wenn Unternehmen diese Rechte missachten, können sie ernsthaften Geschäftsrisiken wie Verzögerungen in der Projektplanung oder unerwarteten Rechtsstreitigkeiten gegenüberstehen. Das Recht auf Veröffentlichung, das Recht auf Namensnennung und insbesondere das Recht auf Werksintegrität haben direkte Auswirkungen auf die PR-, Entwicklungs- und Marketingaktivitäten eines Unternehmens. Der sicherste Weg, diese Risiken effektiv zu managen, besteht darin, Maßnahmen sowohl intern als auch in externen Verträgen zu ergreifen. Für von Mitarbeitern geschaffene Werke ist es unerlässlich, die Anforderungen des Systems der Diensterfindungen genau zu verstehen und interne Richtlinien sowie Verfahren zur sicheren Anwendung zu etablieren. Bei der Zusammenarbeit mit externen Kreativen wie Freiberuflern oder Auftragnehmern ist es äußerst wichtig, klare und spezifische Verträge abzuschließen, die keine Erwartung an die Entstehung von Diensterfindungen haben und die Übertragung von Urheberrechten sowie eine Vereinbarung über die Nichtausübung der Urheberpersönlichkeitsrechte beinhalten.
Die Monolith Rechtsanwaltskanzlei verfügt über umfangreiche Erfahrungen in der Vertretung einer Vielzahl von in- und ausländischen Mandanten in komplexen Fällen, die das japanische Urheberrecht, insbesondere die Urheberpersönlichkeitsrechte, betreffen. Unsere Kanzlei beschäftigt mehrere Experten mit internationalem Hintergrund, einschließlich englischsprachiger Anwälte mit ausländischen Qualifikationen, die in der Lage sind, präzise Beratung aus einer globalen Perspektive zu den japanischen Rechtssystemen zu bieten. Wir bieten alle rechtlichen Unterstützungen an, die im vorliegenden Artikel erläutert wurden, von der Erstellung und Überprüfung von Arbeitsverträgen und Dienstleistungsverträgen über die Entwicklung von internen Richtlinien für das Management von geistigem Eigentum bis hin zur Unterstützung im Falle eines Rechtsstreits.
Category: General Corporate