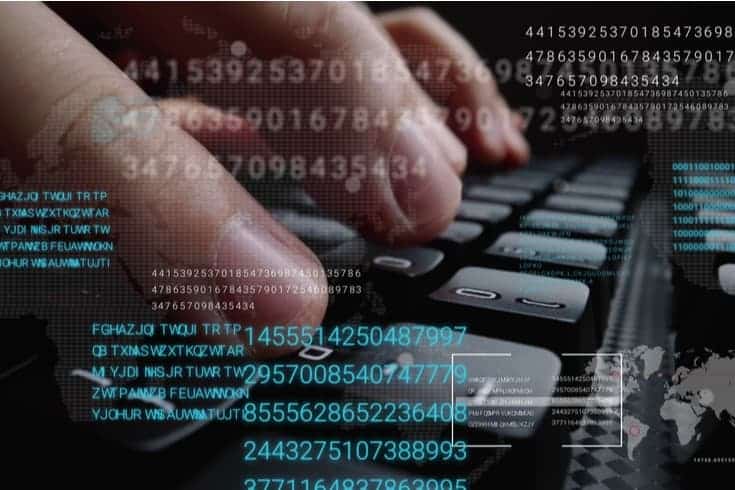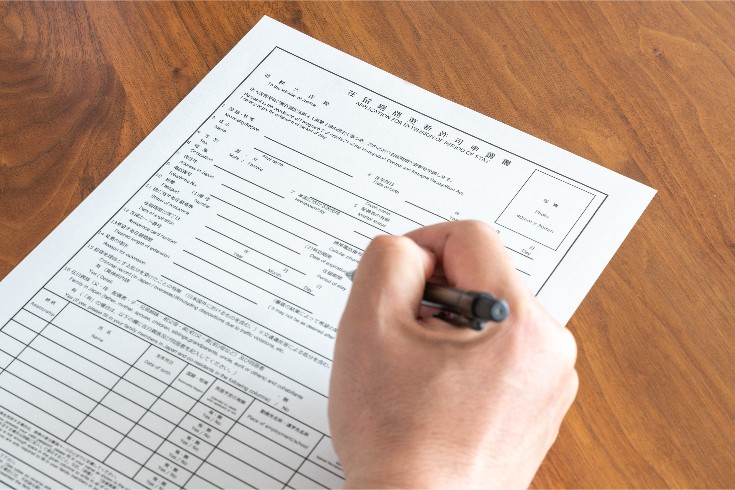Künstliche Intelligenz und das japanische Urheberrecht: Ein rechtlicher Risikoleitfaden für Unternehmen

Künstliche Intelligenz in der Generierung (Generative AI) birgt das Potenzial, alle Aspekte des Geschäftsbetriebs zu revolutionieren. Von der Content-Erstellung über Forschung und Entwicklung bis hin zum Kundenservice – die Anwendungsbereiche erweitern sich täglich. Doch diese technologische Innovation stellt Unternehmen, insbesondere im Zusammenhang mit dem japanischen Urheberrecht, vor neue rechtliche Herausforderungen. Während viele Unternehmen die Einführung von Generative AI in Betracht ziehen oder vorantreiben, ist es entscheidend, die hinter der Bequemlichkeit verborgenen Risiken von Urheberrechtsverletzungen genau zu verstehen und zu managen. Das japanische Urheberrechtsgesetz weist eine charakteristische Struktur auf, die in den verschiedenen Phasen der AI-Entwicklung und -Nutzung unterschiedliche rechtliche Prinzipien anwendet, was zur Komplexität beiträgt. Es ist ein erster Schritt im Risikomanagement, diese Dualstruktur zu verstehen, die in der Lernphase der AI-Entwicklung relativ nachsichtige Regelungen vorsieht, während sie den Nutzern der generierten Produkte strenge Verantwortlichkeiten auferlegt. In diesem Artikel erläutern wir systematisch die wichtigsten rechtlichen Aspekte, die Generative AI im Rahmen des japanischen Urheberrechts mit sich bringt. Konkret geht es um die rechtliche Behandlung von AI in der ‘Entwicklungs- und Lernphase’, das Risiko von Urheberrechtsverletzungen in der ‘Generierungs- und Nutzungsphase’ von Inhalten durch Unternehmen, die Urheberrechtszugehörigkeit der von AI generierten Werke und die Verantwortung und rechtlichen Maßnahmen von Unternehmen im Falle einer Verletzung, unter Berücksichtigung der Ansichten der japanischen Regierungsbehörde, der Agentur für kulturelle Angelegenheiten. Wir präsentieren strategische Ansätze, die von Führungskräften und Rechtsabteilungen in Unternehmen verfolgt werden sollten.
Entwicklung und Lernphase von KI unter dem japanischen Urheberrechtsgesetz
Um hochentwickelte Fähigkeiten zu entfalten, muss eine generative KI eine enorme Menge an Daten lernen. Diese Daten umfassen eine Vielzahl von urheberrechtlich geschützten Werken, darunter Texte, Bilder, Musik und Programmcode. Das japanische Urheberrechtsgesetz erleichtert die Nutzung solcher Werke in der KI-Entwicklung, indem es unter bestimmten Bedingungen auf die Zustimmung des Urhebers verzichtet.
Im Kern steht Artikel 30-4 des japanischen Urheberrechtsgesetzes, der mit der Gesetzesänderung im Jahr 2018 (Heisei 30) eingeführt wurde. Dieser Artikel erlaubt die Nutzung von Werken, die nicht zum Zweck des Genusses der darin ausgedrückten Ideen oder Gefühle erfolgt, und wird als eine “flexible Rechtebeschränkung” angesehen. Das Lernen der KI dient nicht dem Vergnügen des Menschen, also dem “Genuss” von Werken, sondern der Informationsanalyse, um Muster und Strukturen in den Daten zu extrahieren und zu analysieren. Daher können KI-Entwickler grundsätzlich ohne Zustimmung des Urhebers öffentlich zugängliche Daten im Internet für das Lernen verwenden, sofern es sich um eine “nicht-genussorientierte” Nutzung handelt. Diese Regelung steht im Einklang mit der politischen Absicht, die technologische Innovation und die Wettbewerbsfähigkeit der Industrie in Japan zu fördern.
Es gibt jedoch wichtige Ausnahmen von diesem Grundsatz. Artikel 30-4 des japanischen Urheberrechtsgesetzes bestimmt in einer Einschränkung, dass “in Fällen, in denen die Art und der Zweck des Werkes sowie die Art der Nutzung die Interessen des Urhebers ungerechtfertigt beeinträchtigen, dies nicht gilt”. Was als “ungerechtfertigte Beeinträchtigung” gilt, erfordert eine individuelle und konkrete Beurteilung, aber die japanische Kulturbehörde hat in ihrem “Ansatz zu KI und Urheberrecht” einige Typen dargestellt.
Zum Beispiel wird die Handlung, Datenbankwerke, die speziell für KI-Lernzwecke organisiert und verkauft werden, ohne Bezahlung und ohne Erlaubnis zu kopieren und für das Lernen zu nutzen, als hochgradig wahrscheinlich angesehen, den Markt des Datenbankanbieters direkt zu konkurrieren und dessen Interessen ungerechtfertigt zu schädigen. Ebenso kann das gezielte Lernen ausschließlich von Werken eines bestimmten Kreativen, um Inhalte zu erzeugen, die dessen Stil imitieren, als Abweichung vom ursprünglichen “nicht-genussorientierten” Zweck angesehen werden, wobei ein Genusszweck als gleichzeitig vorhanden betrachtet werden könnte. Darüber hinaus wird das Sammeln von Daten aus Quellen, von denen man weiß, dass sie urheberrechtlich geschützte Werke enthalten, um KI zu lernen, als problematisch angesehen, da es die Rechtsverletzung fördert.
Was diese Beispiele zeigen, ist, dass Compliance in der Entwicklungsphase von KI nicht nur eine Frage der technischen Fähigkeit zur Datenreproduktion ist, sondern auch eine anspruchsvollere Beurteilung erfordert, ob die Handlung bestehende Märkte oder die legitimen Interessen der Rechteinhaber wirtschaftlich schädigt. Wenn Unternehmen KI entwickeln oder die Entwicklung in Auftrag geben, ist eine sorgfältige Due-Diligence-Prüfung erforderlich, um sicherzustellen, dass die Herkunft und die Verwendung der Lern-Daten diesen rechtlichen und ethischen Standards entsprechen.
Risiken von Urheberrechtsverletzungen bei der Nutzung von AI-generierten Inhalten
Auch wenn die Entwicklung und das Training von Künstlicher Intelligenz (KI) in Japan gemäß Artikel 30-4 des japanischen Urheberrechtsgesetzes rechtmäßig erfolgen, gibt es keine Garantie, dass die mit dieser KI erzeugten Inhalte nicht das Urheberrecht verletzen. Der rechtliche Schutz beschränkt sich auf die Trainingsphase, und in der Phase der Erzeugung und Nutzung trägt der Anwender der KI das direkte Risiko, für Urheberrechtsverletzungen verantwortlich gemacht zu werden.
In der japanischen Rechtsprechung wird allgemein davon ausgegangen, dass für eine Urheberrechtsverletzung zwei Kriterien erfüllt sein müssen: “Ähnlichkeit” und “Abhängigkeit”. Ähnlichkeit bedeutet, dass das spätere Werk in wesentlichen Teilen der kreativen Ausdrucksform des bestehenden Urheberrechts ähnlich ist. Eine bloße Idee, ein Stil oder allgemein gebräuchliche Ausdrücke reichen für die Feststellung einer Ähnlichkeit nicht aus. Abhängigkeit bedeutet, dass das spätere Werk auf der Grundlage eines bestehenden Werkes geschaffen wurde. Wenn das Werk zufällig und ohne Kenntnis des bestehenden Werkes geschaffen wurde, wird die Abhängigkeit verneint.
Bei der Nutzung von generativer KI ist es durchaus denkbar, dass die erzeugten Inhalte einem bestehenden Urheberrechtswerk ähneln. Problematisch ist die Beurteilung der Abhängigkeit. Wenn der KI-Anwender ein bestimmtes Urheberrechtswerk kennt und Anweisungen (Prompts) gibt, die eine Reproduktion dieses Werkes beabsichtigen, ist die Abhängigkeit offensichtlich gegeben. Komplizierter wird es jedoch, wenn der Anwender das spezifische Urheberrechtswerk nicht kennt, die KI aber aufgrund ihrer Trainingsdaten etwas Ähnliches erzeugt. Zu diesem Punkt gibt es noch keine gefestigte rechtliche Meinung, aber es gibt Diskussionen darüber, dass die Tatsache, dass das betreffende Werk in den Trainingsdaten enthalten war, eine Abhängigkeit nahelegen könnte. Da die Trainingsdaten eines KI-Modells oft umfangreich und wie eine Blackbox behandelt werden, ist es für den Anwender praktisch unmöglich, deren gesamten Inhalt zu erfassen. Dies stellt ein wesentliches rechtliches Risiko dar, das für Unternehmen äußerst schwer zu managen ist.
Da es unmöglich ist, dieses Risiko vollständig zu eliminieren, müssen Unternehmen Risikomanagement betreiben und praktische Maßnahmen ergreifen, um sich auf mögliche Streitigkeiten vorzubereiten. Erstens ist es wichtig, klare Richtlinien für die Nutzung von generativer KI im Unternehmen zu entwickeln und die Schulung der Mitarbeiter zu intensivieren. Es muss festgelegt werden, zu welchem Zweck, mit welchen KI-Tools und auf welche Weise diese genutzt werden dürfen. Zweitens sollte ein Prozess eingeführt werden, bei dem Inhalte, die von KI generiert wurden, insbesondere vor der Veröffentlichung nach außen, immer von Menschen überprüft und bearbeitet werden. KI-generierte Inhalte sollten lediglich als Ausgangspunkt behandelt werden, und durch das Hinzufügen menschlicher kreativer Urteile zum endgültigen Produkt kann die Ähnlichkeit mit dem Originalwerk verringert werden. Drittens ist es wünschenswert, Aufzeichnungen über den Generierungsprozess so weit wie möglich zu bewahren. Aufzeichnungen darüber, welche Prompts zur Erzeugung verwendet wurden, können nützlich sein, um zu belegen, dass keine Verletzungsabsicht vorlag, falls die Abhängigkeit strittig wird.
Vergleich der wichtigsten rechtlichen Aspekte von KI und Urheberrecht
Die rechtlichen Fragen rund um KI und Urheberrecht variieren erheblich je nach dem Stadium im Lebenszyklus der KI. Die folgende Tabelle vergleicht und ordnet die wichtigsten rechtlichen Aspekte in den Phasen “Entwicklung & Lernen” und “Erzeugung & Nutzung”. Durch diesen Vergleich können wir klar verstehen, wie sich die Verantwortlichkeiten und die Natur der Risiken verändern.
| Vergleichskriterien | Entwicklung & Lernphase | Erzeugungs- & Nutzungsphase |
| Relevante Gesetze | Artikel 30-4 des japanischen Urheberrechtsgesetzes | Rechte auf Vervielfältigung und Bearbeitung im japanischen Urheberrecht |
| Zentrale rechtliche Fragen | Ist der Verwendungszweck “nicht zum Genuss” und schadet er “unangemessen” den Interessen des Urhebers? | Ähnelt und basiert das erzeugte Produkt auf einem bestehenden urheberrechtlich geschützten Werk? |
| Hauptverantwortliche | KI-Entwickler | KI-Nutzer |
| Natur des rechtlichen Risikos | Rechtliche Mängel im Entwicklungsprozess durch illegale Datensammlung und -lernen | Direkte Verantwortung für unbeabsichtigte Erzeugung und Veröffentlichung urheberrechtlich geschützter Werke |
Urheberrecht an durch KI generierten Werken in Japan
Wenn Unternehmen Künstliche Intelligenz (KI) nutzen, um Marketingmaterialien, Designs oder Berichte zu erstellen, entsteht eine äußerst wichtige Frage: “Entstehen Urheberrechte an diesen generierten Werken und wenn ja, wem gehören sie?” Dies ist entscheidend, da es darüber bestimmt, ob ein Unternehmen die von ihm erstellten Inhalte als geistiges Eigentum schützen und unbefugte Nutzung durch Dritte verhindern kann.
Das japanische Urheberrechtsgesetz (Artikel 2, Absatz 1, Nummer 1) definiert ein Werk als “eine kreative Ausdrucksform von Gedanken oder Gefühlen, die zu den Bereichen Literatur, Wissenschaft, Kunst oder Musik gehört”. Ein grundlegendes Prinzip dieser Definition ist, dass der Schöpfer des Werks ein Mensch sein muss. Da KI keine Menschen sind, wird KI-generierten Inhalten, die autonom von der KI erstellt wurden, nach geltendem Recht keine Urheberschaft und damit keine Urheberrechte zugesprochen.
Daher hängt die Anerkennung von Urheberrechten an KI-generierten Werken davon ab, ob es einen “kreativen Beitrag” des Menschen im Generierungsprozess gibt. Nur wenn der Mensch die KI als bloßes “Werkzeug” verwendet und seine Gedanken oder Gefühle kreativ ausdrückt, kann der Mensch als Urheber des Werks angesehen und entsprechend geschützt werden.
Ob ein “kreativer Beitrag” anerkannt wird, hängt vom Grad der menschlichen Beteiligung ab. Wenn beispielsweise nur ein einfacher und allgemeiner Prompt wie “eine Katze im Sonnenuntergang” eingegeben wird und die KI den Großteil der konkreten Ausdrucksform autonom bestimmt, wird der kreative Beitrag des Menschen als gering angesehen, und es ist unwahrscheinlich, dass das generierte Werk als urheberrechtlich geschützt anerkannt wird.
Andererseits, wenn ein Mensch eine konkrete kreative Absicht hat und zahlreiche detaillierte Anweisungen in den Prompt einfügt, mehrmals durch Versuch und Irrtum geht, um einen bestimmten Ausdruck hervorzubringen, dann könnte der gesamte Prozess dieser Anweisungen und Auswahl als kreative Handlung bewertet werden, und das Werk könnte als urheberrechtlich geschützt anerkannt werden. Darüber hinaus, wenn ein Mensch mehrere von der KI generierte Bilder auswählt und anordnet und erhebliche Überarbeitungen und Korrekturen vornimmt, um ein Werk zu vollenden, entstehen eindeutige Urheberrechte an den kreativen Bearbeitungs- und Verarbeitungsteilen durch den Menschen.
Dies bietet Unternehmen eine wichtige strategische Einsicht. Um wertvolles geistiges Eigentum mit Hilfe von KI zu schaffen, ist es unerlässlich, nicht nur die Generierung durch KI anzuweisen, sondern auch den kreativen Beitrag des Menschen absichtlich in den Prozess einzubeziehen und diesen zu dokumentieren. Die Aufzeichnung der detaillierten Prompt-Historie, des Auswahlprozesses der generierten Ergebnisse und des konkreten Inhalts der menschlichen Nachbearbeitung kann ein wichtiger Beweis sein, um in Zukunft die Urheberrechte an diesem Inhalt zu beanspruchen und zu schützen.
Verantwortlichkeit und rechtliche Maßnahmen, mit denen Unternehmen in Japan konfrontiert werden
Wenn ein Unternehmen durch die Nutzung von generativer KI unbeabsichtigt Urheberrechte verletzt, kann es schwerwiegenden rechtlichen Maßnahmen gegenüberstehen. Urheber haben das Recht, ihre Ansprüche unter dem japanischen Urheberrechtsgesetz und dem japanischen Zivilgesetzbuch durchzusetzen, was ihnen mehrere starke rechtliche Mittel zur Verfügung stellt.
Die direkteste Maßnahme ist der zivilrechtliche Anspruch. Urheber können eine Unterlassungsklage einreichen, um die Beendigung oder Verhinderung der Verletzung zu fordern. Dies zwingt das Unternehmen, die Nutzung des verletzenden Inhalts sofort einzustellen und beispielsweise von ihrer Website zu entfernen. Darüber hinaus kann der Urheber Schadensersatz für den durch die Verletzung entstandenen Schaden verlangen. Die Berechnung des Schadens kann komplex sein, kann aber aufgrund des durch die Verletzung erzielten Gewinns des Unternehmens hoch ausfallen. Wenn das Urheberpersönlichkeitsrecht verletzt wird, kann auch die Forderung nach Maßnahmen zur Wiederherstellung des Rufs, wie die Veröffentlichung einer Entschuldigungsanzeige, erhoben werden.
Zusätzlich zur zivilrechtlichen Haftung kann eine Urheberrechtsverletzung auch strafrechtlich verfolgt werden. In besonders schweren Fällen kann es aufgrund einer Anzeige des Rechteinhabers zu einem Strafverfahren kommen. Für Einzelpersonen kann dies zu einer Freiheitsstrafe von bis zu zehn Jahren oder einer Geldstrafe von bis zu 10 Millionen Yen führen, während für juristische Personen, die die Verletzung im Rahmen ihrer Geschäftstätigkeit begehen, eine Geldstrafe von bis zu 300 Millionen Yen verhängt werden kann.
Die Verantwortung liegt grundsätzlich bei dem Nutzer der KI, also dem Unternehmen selbst. Wenn jedoch der von den KI-Entwicklern bereitgestellte Dienst so konzipiert ist, dass er absichtlich oder mit hoher Wahrscheinlichkeit Werke erzeugt, die bestimmten urheberrechtlich geschützten Werken ähneln, kann auch der Entwickler eine Mitverantwortung tragen.
Derzeit gibt es in Japan noch wenige gerichtliche Entscheidungen, die sich direkt mit Urheberrechtsfragen bei generativer KI befassen. Allerdings haben bereits konkrete Streitigkeiten stattgefunden, wie zum Beispiel eine Klage einer großen japanischen Zeitung gegen einen ausländischen KI-Anbieter, der ohne Erlaubnis kostenpflichtige Artikel für das Training und die Nutzung seiner KI verwendet hat. In einer solchen Situation, in der gerichtliche Entscheidungen fehlen, sind die offiziellen Ansichten und Richtlinien der oben erwähnten Kulturbehörde von entscheidender Bedeutung als de facto Verhaltenskodex für Unternehmen, um rechtliche Risiken zu bewerten und die zu befolgenden Standards zu bestimmen. Daher sollte die Compliance-Strategie eines Unternehmens darauf basieren, den Anweisungen dieser Behörde strikt zu folgen.
Zusammenfassung
Generative KI kann Unternehmen unermessliche Vorteile bringen, birgt jedoch unter dem japanischen Urheberrechtsgesetz erhebliche rechtliche Risiken. Das japanische Rechtssystem weist eine duale Struktur auf, die einerseits im Lernstadium der KI-Entwicklung eine flexible Handhabung erlaubt, andererseits aber den Nutzern generierter Inhalte strenge urheberrechtliche Verantwortlichkeiten auferlegt. Ein tiefes Verständnis dieser Struktur ist der Schlüssel dafür, dass Unternehmen KI-Technologien sicher nutzen können. Selbst wenn die Lern-Daten der KI rechtmäßig gesammelt wurden, kann der Nutzer, der Inhalte generiert, die existierenden Werken ähneln, ernsthaften zivil- und strafrechtlichen Haftungen ausgesetzt sein. Es ist unerlässlich, dass Unternehmen aktive und konkrete Risikomanagementmaßnahmen ergreifen, wie die Erstellung interner Richtlinien, die Einführung eines gründlichen Überprüfungsprozesses durch Menschen und die Dokumentation des kreativen Prozesses zur Sicherung von geistigem Eigentum.
Die Monolith Rechtsanwaltskanzlei hat eine umfangreiche Erfolgsbilanz bei der Beratung zahlreicher inländischer Klienten zu komplexen rechtlichen Herausforderungen rund um generative KI und Urheberrechte in Japan. Unsere Kanzlei beschäftigt mehrere Experten, die nicht nur über japanische Anwaltsqualifikationen verfügen, sondern auch über ausländische Rechtsqualifikationen und Englisch sprechen, was es uns ermöglicht, Unternehmen, die international agieren, eine detaillierte Unterstützung bei der präzisen Anpassung an das japanische Rechtssystem zu bieten. Wir bieten spezialisierte Rechtsdienstleistungen an, wie Beratung zu den in diesem Artikel erläuterten Themen und Unterstützung beim Aufbau konkreter interner Strukturen.
Category: General Corporate