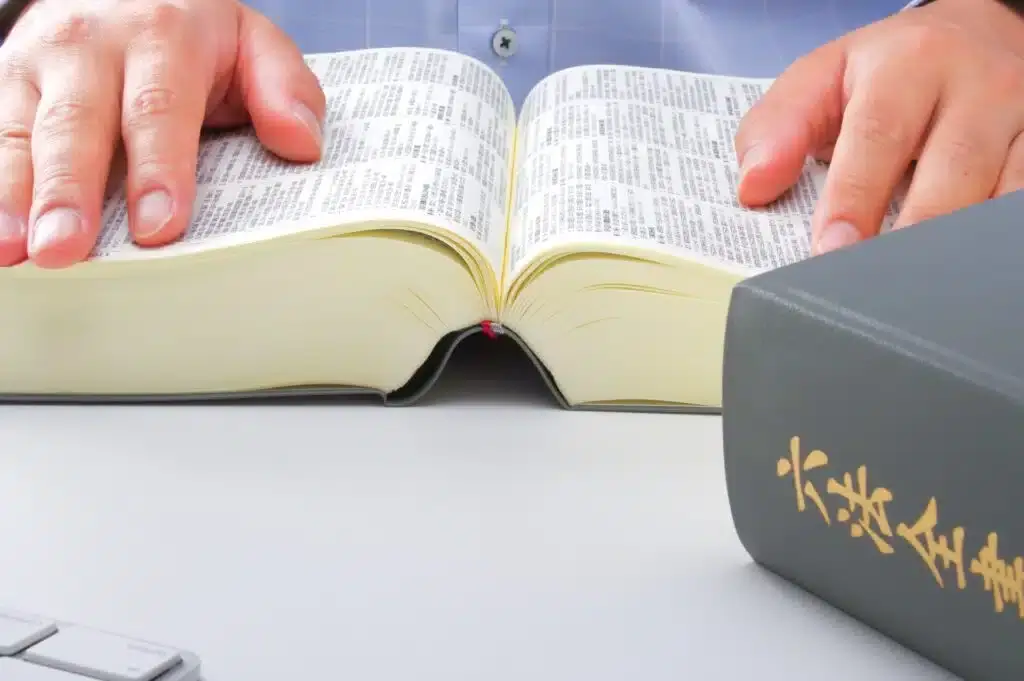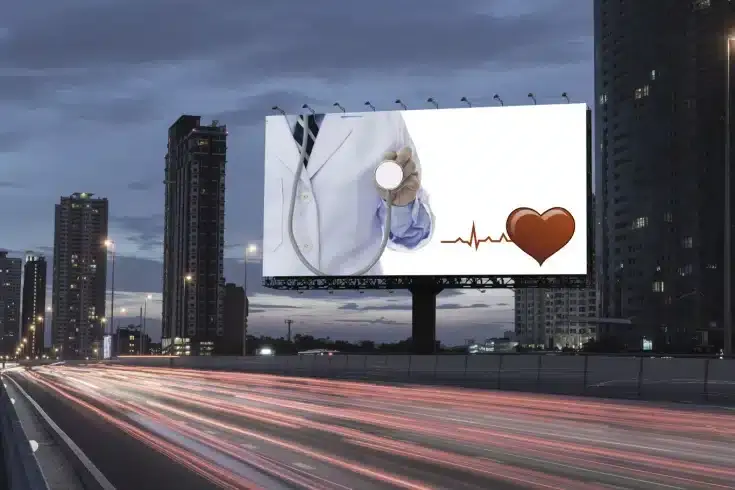Erläuterung der Entstehung von Rechten und der Schutzdauer im japanischen Urheberrecht

In der intellektuellen Vermögensportfolio eines Unternehmens bilden Urheberrechte das Fundament zum Schutz einer Vielzahl von Vermögenswerten wie Software, Marketingmaterialien, Forschungs- und Entwicklungsberichte und Designs. Insbesondere für global agierende Unternehmen ist es von entscheidender Bedeutung, die Eigenschaften der rechtlichen Systeme verschiedener Länder, insbesondere des japanischen Urheberrechtssystems, genau zu verstehen, um Vermögensverwaltung und Risikovermeidung zu optimieren. Das japanische Urheberrechtssystem teilt zwar eine gemeinsame Basis mit vielen weltweit angewandten Systemen, weist jedoch in Bezug auf den Mechanismus der Rechteentstehung und die Berechnungsmethoden der Schutzdauer eigene Prinzipien auf. Das japanische Urheberrechtsgesetz verfolgt den Grundsatz der Formalitätsfreiheit, der keine Registrierung oder Anmeldung bei einer Behörde für das Entstehen von Rechten erfordert. Dies bedeutet, dass rechtlicher Schutz automatisch mit dem Abschluss der kreativen Tätigkeit gewährt wird. Allerdings gilt dieser automatische Schutz nicht für alle Ergebnisse. Um als rechtlich geschütztes ‘Werk’ anerkannt zu werden, muss das Ergebnis das Kriterium der ‘Originalität’ erfüllen. Dieses Kriterium ist ein wichtiger Maßstab, um zwischen einer bloßen Sammlung von Fakten oder Daten und dem Ergebnis einer intellektuellen Schöpfung zu unterscheiden. Ebenso wichtig ist es zu verstehen, wie lange dieser Schutz andauert, d.h. die Schutzdauer. Das japanische Urheberrechtsgesetz wendet zwei Hauptprinzipien bei der Berechnung der Schutzdauer an: ein Prinzip, das auf dem Zeitpunkt nach dem Tod des Urhebers basiert, und ein Ausnahmeprinzip, das auf dem Zeitpunkt der Veröffentlichung des Werkes basiert. Welches dieser Prinzipien zur Anwendung kommt, wird durch die Art des Werkes und die Darstellungsform des Urhebers bestimmt. Diese komplexen Regeln bieten einen vorhersehbaren rechtlichen Rahmen, um den Wert immaterieller Vermögenswerte eines Unternehmens zu maximieren und deren Lebenszyklus zu verwalten. Dieser Artikel erläutert detailliert die Anforderungen für das Entstehen von Rechten im japanischen Urheberrecht, die konkreten Berechnungsmethoden der Schutzdauer und den Prozess bis zu deren Erlöschen, basierend auf Gesetzen und Gerichtsentscheidungen.
Entstehung von Urheberrechten: Formfreiheit und Kreativitätserfordernis unter japanischem Recht
In Japan entstehen Urheberrechte automatisch, sobald bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind. Das Verständnis dieses Mechanismus ist der erste Schritt, um die eigenen Rechte angemessen zu verwalten und die Rechte anderer nicht zu verletzen. Hier erläutern wir die zwei zentralen Elemente für die Entstehung von Rechten: die “Formfreiheit” und das “Kreativitätserfordernis”.
Formfreiheit
Eines der grundlegendsten Prinzipien des japanischen Urheberrechtssystems ist die “Formfreiheit”. Dies bedeutet, dass für die Entstehung und den Genuss von Urheberrechten keine formellen Verfahren erforderlich sind. Konkret bedeutet dies, dass im Gegensatz zu Patenten oder Markenrechten, die eine Anmeldung oder Registrierung bei einer Behörde erfordern, Urheberrechte automatisch im Moment der Schöpfung eines Werkes an den Urheber vergeben werden. Dieses Prinzip ist in Artikel 17 Absatz 2 des japanischen Urheberrechtsgesetzes klar definiert: “Für den Genuss des Urheberpersönlichkeitsrechts und des Urheberrechts ist keine formelle Handlung erforderlich.”
Durch die Formfreiheit werden beispielsweise Berichte von Unternehmensmitarbeitern, von Designern erstellte Grafiken oder von Programmierern geschriebener Quellcode unmittelbar nach ihrer Fertigstellung durch das Urheberrechtsgesetz geschützt. Auch die häufig auf Webseiten und in Publikationen zu sehende ©-Markierung (Copyright-Zeichen) ist keine Voraussetzung für die Entstehung von Rechten. Das ©-Zeichen ist eine konventionelle Angabe, die faktisch auf das Bestehen von Urheberrechten hinweist, und ihr Vorhandensein oder Fehlen hat keinen Einfluss auf die Gültigkeit der Rechte.
Dieses Prinzip vereinfacht den Prozess des Rechtserwerbs und fördert kreative Aktivitäten. Es bedeutet jedoch auch, dass die Verantwortung für den Nachweis der Existenz und Zugehörigkeit von Rechten beim Rechteinhaber liegt. Im Falle eines Streits muss nachgewiesen werden, wer wann und was erschaffen hat, was die Notwendigkeit einer sorgfältigen Dokumentation des Schöpfungsdatums und der Vertragsverwaltung mit sich bringt.
Kreativität als Voraussetzung für die Werkqualität
Während Urheberrechte formfrei und automatisch entstehen, ist ihr Schutz auf rechtlich definierte “Werke” beschränkt. Artikel 2 Absatz 1 Nummer 1 des japanischen Urheberrechtsgesetzes definiert ein Werk als “eine kreative Ausdrucksform von Gedanken oder Gefühlen, die zu den Bereichen Literatur, Wissenschaft, Kunst oder Musik gehört”. Innerhalb dieser Definition ist das “Kreativitätserfordernis” die praktisch wichtigste Voraussetzung.
Kreativität bedeutet, dass irgendeine Form von Individualität des Autors zum Ausdruck kommt, und es wird nicht notwendigerweise ein hohes Maß an künstlerischer Qualität, Neuheit oder Originalität verlangt. Wenn das Ergebnis der intellektuellen Tätigkeit des Schöpfers erkennbar ist und es sich nicht nur um eine einfache Nachahmung eines anderen Werkes handelt, wird in der Regel Kreativität anerkannt. Umgekehrt wird Werken, die bei der Erstellung durch jedermann ähnlich ausfallen würden oder die lediglich Fakten oder Daten selbst darstellen, keine Kreativität zuerkannt, und sie werden nicht als urheberrechtlich geschützte Werke anerkannt.
Ein repräsentatives Gerichtsurteil, in dem die Kreativität strittig war, ist der “NTT Town Page Database-Fall” (Urteil des Bezirksgerichts Tokio vom 16. Mai 1997). In diesem Fall wurde die Werkqualität der “Town Page”, einer nach Berufen klassifizierten Telefonbuchdatenbank, hinterfragt. Das Gericht entschied, dass die berufliche Klassifizierungssystematik der “Town Page”, im Gegensatz zu den lediglich alphabetisch angeordneten Namen in den “Hello Pages”, durch die Auswahl und Anordnung der Informationen eine kreative Leistung des Erstellers darstellt und somit Kreativität anerkannt werden kann. Insbesondere wurde das eigens für die Suchbequemlichkeit entwickelte Klassifizierungssystem als kreative Ausdrucksform bewertet, die über eine bloße Datensammlung hinausgeht.
Dieser Fall gibt wichtige Hinweise darauf, wie Unternehmen ihre Informationsressourcen betrachten sollten. Ob Datenbanken, die Kundendaten oder Verkaufsdaten eines Unternehmens enthalten, urheberrechtlich geschützt sind oder nicht, hängt davon ab, ob die “Auswahl oder systematische Anordnung” dieser Informationen Kreativität aufweist (Artikel 12-2 des japanischen Urheberrechtsgesetzes). Wenn diese Anordnung alltäglich ist oder sich zwangsläufig aus einem bestimmten Zweck ergibt, wird die Kreativität verneint, und die Datenbank könnte keinen urheberrechtlichen Schutz genießen. Unternehmen müssen daher genau bewerten, ob ihre Informationsressourcen lediglich eine Datensammlung oder ein kreatives Werk darstellen, und eine mehrschichtige Informationsmanagementstrategie entwickeln, die auch andere Schutzmaßnahmen berücksichtigt (zum Beispiel Schutz als Geschäftsgeheimnis nach dem Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb oder vertraglicher Schutz).
Die Betrachtungsweise der Schutzfristen im japanischen Urheberrecht
Wenn Urheberrechte einmal entstanden sind, bedeutet das nicht, dass diese Rechte ewig andauern. Das japanische Urheberrechtsgesetz schützt die Rechte der Urheber, während es gleichzeitig vorsieht, dass Werke nach Ablauf einer bestimmten Frist als kulturelles Gut der Allgemeinheit (Public Domain) freigegeben werden, um deren freie Nutzung zu fördern und somit zur kulturellen Entwicklung beizutragen. Daher ist eine klare Schutzfrist für Urheberrechte festgelegt.
Um die Berechnungsmethode der Schutzfrist zu verstehen, ist es zunächst wichtig, das grundlegende Prinzip des “Kalenderjahrsystems” zu erfassen. Artikel 57 des japanischen Urheberrechtsgesetzes legt fest, dass bei der Berechnung des Endes der Schutzfrist der “1. Januar des Folgejahres” nach dem Jahr des Ereignisses, das den Beginn markiert – wie dem Todestag des Urhebers, dem Veröffentlichungsdatum oder dem Schöpfungsdatum des Werkes – als Startdatum für die Berechnung dient. Wenn beispielsweise ein Urheber am 15. Mai 2024 verstirbt, dann ist der 1. Januar 2025 das Startdatum für die Berechnung der Schutzfrist seines Werkes. Wenn die Schutzfrist 70 Jahre beträgt, endet diese am 31. Dezember 2094. Dieses Kalenderjahrsystem dient der Vereinfachung der Berechnung und wird einheitlich auf alle Schutzfristberechnungen angewendet.
Die Betrachtungsweise der Schutzfristen im japanischen Urheberrechtsgesetz gliedert sich im Wesentlichen in zwei Systeme. Das eine ist das “Todestagsprinzip”, das angewendet wird, wenn der Urheber eine natürliche Person ist. Das andere ist das “Veröffentlichungsprinzip”, das zur Anwendung kommt, wenn der Urheber nicht eindeutig identifizierbar ist oder es sich um eine juristische Person handelt. Je nachdem, welches Prinzip zur Anwendung kommt, kann die Länge der Schutzfrist stark variieren, weshalb es unerlässlich ist, den Unterschied genau zu verstehen.
Grundsätzliche Schutzdauer: 70 Jahre nach dem Tod des Urhebers
Ein grundlegendes Prinzip der Schutzdauer im japanischen Urheberrecht ist, dass die Rechte 70 Jahre nach dem Tod des Urhebers bestehen bleiben. Dies gilt, wenn der Urheber eine natürliche Person ist und das Werk unter seinem wirklichen Namen (oder einem weit bekannten Pseudonym) veröffentlicht wurde. Artikel 51 Absatz 2 des japanischen Urheberrechtsgesetzes bestimmt, dass „das Urheberrecht … bis zum Ablauf von 70 Jahren nach dem Tod des Urhebers besteht“. Diese Frist dient nicht nur während der Lebenszeit des Urhebers, sondern auch nach seinem Tod für einen bestimmten Zeitraum dazu, die Interessen der Rechtsnachfolger, wie Familienangehörige, zu schützen.
Die Schutzdauer war früher „50 Jahre nach dem Tod“, wurde jedoch mit der Umsetzung des Transpazifischen Partnerschaftsabkommens (TPP11) am 30. Dezember 2018 auf „70 Jahre nach dem Tod“ verlängert. Diese Verlängerung dient der Harmonisierung mit internationalen Standards. Ein wichtiger Punkt ist, dass für Werke, deren Urheberrechte zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Gesetzesänderung bereits erloschen waren, die Schutzdauer nicht rückwirkend verlängert wird. Dies wird als Prinzip der „Nicht-Rückwirkung des Schutzes“ bezeichnet.
Bei Werken, die von mehreren Urhebern gemeinsam geschaffen wurden, sogenannten „Gemeinschaftswerken“, wird die Schutzdauer etwas anders berechnet. In diesem Fall bestimmt Artikel 51 Absatz 2 des japanischen Urheberrechtsgesetzes in einer Klammerbemerkung, dass die Schutzdauer „70 Jahre nach dem Tod des zuletzt verstorbenen Urhebers“ beträgt. Wenn beispielsweise ein Roman von zwei Autoren gemeinsam verfasst wurde, erlischt das Urheberrecht nicht mit dem Tod des zuerst verstorbenen Autors, sondern die Berechnung der 70 Jahre beginnt erst mit dem Tod des zweiten Autors. Dies berücksichtigt, dass der Beitrag jedes Urhebers zu einem Gemeinschaftswerk untrennbar und einheitlich ist.
Außergewöhnliche Schutzfristen nach japanischem Urheberrecht
In Fällen, in denen es schwierig oder unangemessen ist, die Schutzfrist des Urheberrechts anhand des Todes des Urhebers zu bestimmen, bietet das japanische Urheberrechtsgesetz Ausnahmen. Dies trifft beispielsweise zu, wenn unklar ist, wer der Urheber ist oder wenn der Urheber eine juristische Person ohne das Konzept des “Todes” ist. Um solche Fälle zu adressieren, legt das japanische Urheberrechtsgesetz außergewöhnliche Schutzfristen fest, die sich beispielsweise auf den Zeitpunkt der Veröffentlichung des Werkes beziehen. Diese Ausnahmeregelungen sind von großer praktischer Bedeutung, da sie auf viele im Rahmen der Unternehmensaktivitäten erstellte Werke angewendet werden.
Anonyme und unter Pseudonym veröffentlichte Werke
Bei Werken, deren Urheber anonym bleiben oder die unter einem Pseudonym (wie einem Künstlernamen) veröffentlicht werden, ist es schwierig, den Todeszeitpunkt des Urhebers objektiv festzustellen. Deshalb legt Artikel 52 des japanischen Urheberrechtsgesetzes fest, dass der Schutzzeitraum für diese Werke “70 Jahre nach ihrer Veröffentlichung” beträgt.
Es gibt jedoch einige Ausnahmen von dieser Regelung. Wenn vor Ablauf der 70 Jahre nach Veröffentlichung klar wird, dass seit dem Tod des Urhebers bereits 70 Jahre vergangen sind, endet der Schutzzeitraum zu diesem Zeitpunkt. Außerdem wechselt der Schutzzeitraum zum Grundsatz “70 Jahre nach dem Tod” über, wenn der Urheber innerhalb einer bestimmten Frist eine der folgenden Aktionen durchführt:
- Der Urheber registriert seinen wirklichen Namen bei der japanischen Kulturbehörde (Artikel 75 des japanischen Urheberrechtsgesetzes).
- Der Urheber veröffentlicht sein Werk erneut, wobei er seinen wirklichen Namen oder ein allgemein bekanntes Pseudonym als Urhebername angibt.
Diese Bestimmungen bieten dem Urheber oder seinen Erben Optionen, um eine längere Schutzdauer zu sichern.
Urheberrechtliche Werke im Namen von Organisationen
Viele von Unternehmen erstellte Werke fallen in diese Kategorie. Bei Werken, die im Namen einer juristischen Person oder einer anderen Organisation als Urheber stehen, den sogenannten “Dienstwerken” oder “Körperschaftswerken”, kann das Prinzip der Berechnung der Schutzfrist ab dem Todeszeitpunkt nicht angewendet werden, da juristische Personen nicht wie natürliche Personen “sterben”. Daher legt Artikel 53 des japanischen Urheberrechtsgesetzes fest, dass die Schutzdauer für diese Urheberrechte “70 Jahre nach der Veröffentlichung des Werkes” beträgt. Wurde das Werk innerhalb von 70 Jahren nach seiner Schöpfung nicht veröffentlicht, endet die Schutzfrist “70 Jahre nach seiner Schöpfung”.
Entscheidend ist hier, unter welchen Umständen eine juristische Person als “Urheber” gilt. Dies wird durch die Anforderungen an “Dienstwerke” nach Artikel 15 des japanischen Urheberrechtsgesetzes bestimmt. Konkret bedeutet dies, dass Werke (mit Ausnahme von Computerprogrammen), die (1) auf Initiative der juristischen Person, (2) von einer Person, die für diese juristische Person arbeitet, (3) im Rahmen ihrer Dienstpflichten erstellt und (4) im Namen der juristischen Person veröffentlicht werden, (5) sofern keine gesonderte Vereinbarung durch Vertrag oder Arbeitsordnung getroffen wurde, als Werke gelten, bei denen die juristische Person als Urheber angesehen wird.
Das bedeutet, dass ein Unternehmen, um als Rechtssubjekt des Urheberrechts anerkannt zu werden und die Schutzfrist von 70 Jahren nach der Veröffentlichung zu erhalten, zunächst die Anforderungen an ein Dienstwerk erfüllen muss. Klare Regelungen in Arbeitsverträgen oder Betriebsordnungen über die Rechte an von Mitarbeitern erstellten Werken zu treffen, ist nicht nur für die Bestimmung des Rechteinhabers von Bedeutung, sondern hat auch indirekte Auswirkungen auf die Dauer des Bestehens dieser Rechte durch die Anwendung unterschiedlicher gesetzlicher Bestimmungen, was äußerst wichtig ist.
Das Urheberrecht an Filmen in Japan
Das Urheberrecht an Filmen unterscheidet sich von anderen Werken, da es oft eine Vielzahl von Mitarbeitern und erhebliche Kapitalinvestitionen erfordert. Daher gibt es spezielle Bestimmungen für die Schutzdauer. Artikel 54 des japanischen Urheberrechtsgesetzes bestimmt, dass das Urheberrecht an einem Filmwerk “70 Jahre nach dessen Veröffentlichung” besteht. Ähnlich wie bei Werken, die im Namen einer Organisation veröffentlicht werden, erlischt das Urheberrecht, wenn das Werk innerhalb von 70 Jahren nach seiner Schöpfung nicht veröffentlicht wird, “70 Jahre nach dessen Schöpfung”.
Um die Schutzdauer von Filmwerken gab es wichtige Gerichtsentscheidungen, die sich mit Gesetzesänderungen und dem Grundsatz der Nicht-Rückwirkung befassten. Ein solcher Fall ist das “Shane-Urteil” (Oberster Gerichtshof, Urteil vom 18. Dezember 2007 (Heisei 19)). Dieser Fall betraf den im Jahr 1953 veröffentlichten Film “Shane”. Nach dem damaligen Urheberrechtsgesetz betrug die Schutzdauer für Filme 50 Jahre nach der Veröffentlichung, und das Urheberrecht an “Shane” hätte am 31. Dezember 2003 enden sollen. Jedoch wurde mit dem am 1. Januar 2004 in Kraft getretenen geänderten Urheberrechtsgesetz die Schutzdauer für Filme auf 70 Jahre nach der Veröffentlichung verlängert. Die Rechteinhaber behaupteten, dass diese Verlängerung auch auf “Shane” anwendbar sei.
Der Oberste Gerichtshof wies jedoch die Behauptung der Rechteinhaber zurück. Der Grund für das Urteil war, dass das Urheberrecht an “Shane” bereits am Vortag, dem 31. Dezember 2003, erloschen war und somit in das öffentliche Eigentum übergegangen war. Ein einmal erloschenes Recht kann durch eine spätere Gesetzesänderung nicht wiederbelebt werden, was das Prinzip der Nicht-Rückwirkung von Gesetzen bestätigte.
Das Urteil war nicht nur für die Bestimmung der Rechtsdauer eines einzelnen Films von Bedeutung. Es zeigte auch eine klare rechtliche Stabilität hinsichtlich der Auswirkungen von Gesetzesänderungen auf die Schutzdauer von Urheberrechten. Unternehmen, die ältere Werke nutzen möchten, können sich darauf verlassen, dass die Bestimmung, ob ein Werk im öffentlichen Eigentum liegt, auf der Grundlage des zum Zeitpunkt des Rechtsablaufs geltenden Gesetzes sicher getroffen werden kann. Dies gewährleistet die Vorhersehbarkeit und zeigt, dass das öffentliche Eigentum als stabile kulturelle Ressource genutzt werden kann, ohne das Risiko einer Umkehrung durch zukünftige Gesetzesänderungen.
Vergleich der Schutzfristen
In der folgenden Tabelle fassen wir die bisher erläuterten Prinzipien und Ausnahmen bezüglich der Schutzfristen von Urheberrechten zusammen. Diese Tabelle dient dazu, auf einen Blick zu erfassen, welche Schutzfristen für welche Arten von Werken gelten und ab wann diese Berechnung beginnt.
| Art des Werkes | Schutzfrist | Berechnungsstart | Rechtsgrundlage |
| Werke unter wahrem Namen | 70 Jahre nach dem Tod des Urhebers | 1. Januar des Jahres nach dem Tod des Urhebers | Artikel 51 des japanischen Urheberrechtsgesetzes |
| Gemeinschaftswerke | 70 Jahre nach dem Tod des zuletzt verstorbenen Urhebers | 1. Januar des Jahres nach dem Tod des zuletzt verstorbenen Urhebers | Artikel 51 des japanischen Urheberrechtsgesetzes |
| Anonyme oder pseudonyme Werke | 70 Jahre nach Veröffentlichung | 1. Januar des Jahres nach der Veröffentlichung des Werkes | Artikel 52 des japanischen Urheberrechtsgesetzes |
| Werke im Namen einer Organisation | 70 Jahre nach Veröffentlichung | 1. Januar des Jahres nach der Veröffentlichung des Werkes | Artikel 53 des japanischen Urheberrechtsgesetzes |
| Filmwerke | 70 Jahre nach Veröffentlichung | 1. Januar des Jahres nach der Veröffentlichung des Werkes | Artikel 54 des japanischen Urheberrechtsgesetzes |
Zusammenfassung
Wie in diesem Artikel detailliert beschrieben, basiert das japanische Urheberrechtssystem auf einem klaren rechtlichen Rahmen, der von der Entstehung bis zum Erlöschen von Rechten reicht. Bei der Entstehung der Rechte wird ein “formloses Prinzip” angewendet, das keine Registrierung erfordert, aber als Voraussetzung für den Schutz wird “Kreativität” verlangt. Dies deutet darauf hin, dass nicht alle von einem Unternehmen erzeugten Informationen automatisch geschützt sind, was ein wichtiger Punkt für das Asset-Management ist. Was die Schutzdauer betrifft, so gilt für Werke von Einzelpersonen grundsätzlich das Prinzip “70 Jahre nach dem Tod”, während für Werke, die im Namen von Unternehmen oder für Filmwerke, die eng mit Unternehmensaktivitäten verbunden sind, ausnahmsweise das Prinzip “70 Jahre nach Veröffentlichung” gilt. Es ist unerlässlich, diese Regeln genau zu verstehen und zu wissen, welcher Kategorie die von einem Unternehmen gehaltenen oder genutzten Urheberrechte angehören und wie lange sie geschützt sind, um eine Strategie für das geistige Eigentum zu entwickeln.
Die Monolith Rechtsanwaltskanzlei verfügt über tiefgreifende Fachkenntnisse im japanischen Urheberrecht und eine umfangreiche Erfolgsbilanz in der Beratung von in- und ausländischen Mandanten. Insbesondere sind wir darauf spezialisiert, strategische Rechtsunterstützung für Unternehmen zu bieten, die mit grenzüberschreitenden Fragen des geistigen Eigentums im Rahmen ihrer internationalen Geschäftstätigkeit konfrontiert sind. Unsere Kanzlei beschäftigt mehrere Experten, die auch als ausländische Anwälte qualifiziert sind und Englisch sprechen, was es uns ermöglicht, kulturelle und rechtliche Unterschiede zu überwinden und durch reibungslose Kommunikation optimale Lösungen zu bieten, die das Geschäft unserer Mandanten zum Erfolg führen. Wir stehen Ihnen für alle Anfragen zur Verfügung, die sich auf die in diesem Artikel behandelten Themen wie Urheberrechtsmanagement, Lizenzverträge und Streitbeilegung beziehen.
Category: General Corporate