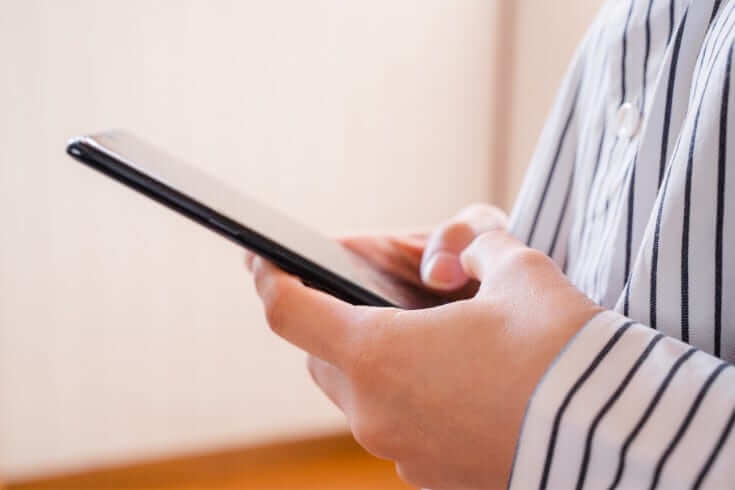Erläuterung der Rechtebeschränkungen im japanischen Urheberrecht: Verständnis der Ausnahmevorschriften und deren Anwendung in der Praxis

Das japanische Urheberrechtsgesetz (Copyright Law of Japan) verfolgt den Grundsatz der Formalitätsfreiheit, wonach Urheberrechte automatisch mit der Schöpfung des Werkes entstehen und dem Urheber einen starken Schutz gewähren. Grundsätzlich stellt die Nutzung eines urheberrechtlich geschützten Werkes ohne Zustimmung des Rechteinhabers eine Urheberrechtsverletzung dar. Doch das japanische Urheberrechtsgesetz strebt in seinem ersten Artikel eine Harmonisierung zwischen dem Schutz der Rechte des Urhebers und dem Beitrag zur Entwicklung der Kultur an. Um dieses Gleichgewicht zu erreichen, sind in den Artikeln 30 bis 50 des Gesetzes Ausnahmen festgelegt, unter denen urheberrechtlich geschützte Werke ohne Zustimmung des Rechteinhabers genutzt werden dürfen – die sogenannten “Beschränkungen des Urheberrechts”. Diese Bestimmungen erlauben keine breite Auslegung, sondern sind eng definierte, begrenzte Ausnahmen, die je nach individuellem Nutzungszweck und -art gelten. Für Unternehmen, insbesondere für solche mit globaler Geschäftstätigkeit, ist ein genaues Verständnis dieser Beschränkungen unerlässlich, um das Risiko unbeabsichtigter Urheberrechtsverletzungen zu vermeiden und einen rechtmäßigen Geschäftsbetrieb zu gewährleisten. In diesem Artikel erläutern wir fachkundig die Bestimmungen, die für die IT-Praxis von Unternehmen von großer Bedeutung sind, die grundlegenden Prinzipien, die die Anwendung der Rechtsbeschränkungen beeinflussen, die wichtige Beziehung zum Urheberpersönlichkeitsrecht sowie die Konzepte von Fair Use und Parodie im japanischen Rechtssystem, basierend auf Gesetzen und Gerichtsentscheidungen.
Einschränkungen des Urheberrechts in der IT-Umgebung von Unternehmen in Japan
IT-Infrastruktur ist für moderne Unternehmensaktivitäten unerlässlich, doch der alltägliche Betrieb und die Wartung dieser Systeme beinhalten häufig technisch gesehen die “Vervielfältigung” von urheberrechtlich geschützten Werken. Das japanische Urheberrechtsgesetz sieht spezielle Ausnahmeregelungen vor, um sicherzustellen, dass solche für die Geschäftsausführung unerlässlichen Handlungen nicht als Urheberrechtsverletzung gelten.
Vervielfältigung von Computerprogrammen durch den Eigentümer (Artikel 47-3)
Artikel 47-3 Absatz 1 des japanischen Urheberrechtsgesetzes erlaubt dem “Eigentümer” einer Kopie eines Computerprogramms, dieses Programm in dem Umfang zu vervielfältigen oder zu adaptieren (zu ändern), wie es für die Nutzung des Programms auf einem Computer als notwendig erachtet wird.
Die in dieser Bestimmung vorgesehene Nutzung “in dem als notwendig erachteten Umfang” bezieht sich auf konkrete Handlungen im IT-Alltag von Unternehmen. Dazu gehören beispielsweise das Installieren von Software auf Servern oder einzelnen Computerfestplatten, das Erstellen von Backup-Kopien zur Vorsorge gegen Datenverlust oder Beschädigung sowie geringfügige “Adaptionen” zur Gewährleistung der Kompatibilität mit bestimmter Hardware oder zur Fehlerbehebung.
Ein besonders zu beachtender Punkt bei der Anwendung dieser Bestimmung ist jedoch, dass sie sich ausschließlich auf den “Eigentümer” einer Programmkopie beschränkt. Im modernen Geschäftsumfeld ist es üblicher, Software nicht durch Kauf zu “besitzen”, sondern auf Basis von Lizenzverträgen eine “Nutzungserlaubnis” zu erhalten. Wenn ein Unternehmen Software lediglich auf Grundlage eines Lizenzvertrags nutzt, werden die Rechte zur Vervielfältigung und Änderung nicht durch diese Ausnahme des Urheberrechtsgesetzes, sondern durch den Inhalt des Lizenzvertrags geregelt. Wenn der Vertrag die Vervielfältigung streng einschränkt, könnte selbst eine Backup-Erstellung für den Vertragsbruch sorgen, weshalb eine genaue Überprüfung der Vertragsbedingungen äußerst wichtig ist.
Zudem, selbst wenn man Eigentümer des Programms ist, entfällt bei Verlust des Eigentums, beispielsweise durch Verkauf eines Computers, auf dem die Software installiert ist, das Recht, erstellte Backup-Kopien weiterhin zu speichern, und es besteht die Pflicht zur Vernichtung dieser Kopien.
Mit der Nutzung von Werken auf Computern einhergehende Nutzung (Artikel 47-4)
Die ursprünglichen Ausnahmeregelungen für Computerprogramme waren hauptsächlich für die Nutzung von physisch vertriebener Standalone-Software gedacht. Doch in der heutigen IT-Umgebung mit verbreiteter Cloud-Computing- und Netzwerkdiensten treten komplexere Vervielfältigungshandlungen wie Serverwartung, Datenmigration und Systemwiederherstellung nach Ausfällen regelmäßig auf. Diese Handlungen waren durch die traditionellen Bestimmungen nicht ausreichend abgedeckt.
Um diese Kluft zwischen technischer Realität und Gesetz zu schließen, wurden mit der Urheberrechtsreform von 2018 (Heisei 30) flexiblere Beschränkungen der Rechte eingeführt. Im Zentrum stehen Artikel 47-4 und Artikel 47-5.
Artikel 47-4 des japanischen Urheberrechtsgesetzes erlaubt die begleitende Nutzung von Werken auf Computern, um deren Nutzung reibungslos oder effizient zu gestalten. Dazu gehört die Erstellung temporärer Caches zur Beschleunigung der Netzwerkverarbeitung oder das vorübergehende Backup von Daten auf externe Medien während Wartung, Reparatur oder Austausch von Geräten, gefolgt von der Wiederherstellung auf dem ursprünglichen Gerät nach Abschluss der Arbeiten. Dies ermöglicht die Durchführung von IT-Wartungsarbeiten zur Sicherstellung der Geschäftskontinuität, ohne die Interessen der Urheber unangemessen zu beeinträchtigen.
Darüber hinaus erlaubt Artikel 47-4 Absatz 2 Nummer 3 des japanischen Urheberrechtsgesetzes ausdrücklich die Erstellung von Backup-Kopien zur Vorsorge gegen Verlust oder Beschädigung von Servern. Dies stellt eine wesentliche Maßnahme zur Absicherung von Geschäftsdaten im Rahmen von Katastrophenschutz und Wiederherstellungsplänen dar und bietet eine rechtliche Grundlage dafür.
Die Einführung dieser Bestimmungen zeigt, dass das japanische Urheberrechtsgesetz bewusst entwickelt wurde, um starre Regeln an die Realität des technologischen Fortschritts anzupassen und praktikabler zu gestalten. Dadurch wird sichergestellt, dass das Gesetz die legitime Verwaltung der IT-Infrastruktur von Unternehmen nicht behindert.
Grundprinzipien der Anwendung von Urheberrechtsbeschränkungen unter japanischem Recht
Auch wenn eine bestimmte Nutzungshandlung den Beschränkungen des Urheberrechts zu entsprechen scheint, bedeutet dies nicht automatisch, dass sie immer rechtmäßig ist. Das japanische Urheberrechtsgesetz legt mehrere grundlegende, übergreifende Prinzipien fest, die bei der Anwendung dieser Ausnahmebestimmungen zu beachten sind. Wer diese Prinzipien missachtet, läuft Gefahr, dass eine Handlung, die als rechtmäßig angesehen wurde, als illegal eingestuft wird.
Pflicht zur Quellenangabe nach Artikel 48 des japanischen Urheberrechtsgesetzes
Artikel 48 des japanischen Urheberrechtsgesetzes schreibt vor, dass bei der Vervielfältigung und Nutzung eines Werkes gemäß bestimmten Rechtebeschränkungen, wie in Artikel 32 desselben Gesetzes festgelegt, die Quelle angegeben werden muss. Diese Pflicht besteht auch in anderen Fällen, wenn es üblich ist, die Quelle anzugeben.
Die Quellenangabe muss “in einer Weise und in einem Umfang erfolgen, die je nach Art der Vervielfältigung oder Nutzung als angemessen angesehen werden” und umfasst in der Praxis, insbesondere in Unternehmensberichten oder auf Webseiten, in der Regel folgende Informationen:
- Titel des Werkes
- Name des Urhebers
- Im Falle eines Buches: Name des Verlags, Erscheinungsjahr, Seitenzahl
- Im Falle einer Webseite: Name der Seite, URL
Die Angabe der Quelle ist nicht nur eine Frage der Höflichkeit, sondern eine rechtliche Verpflichtung. Wer diese Pflicht vernachlässigt, riskiert möglicherweise die Anwendung von Strafen.
Verbot der zweckfremden Verwendung von Vervielfältigungen (Artikel 49)
Artikel 49 des japanischen Urheberrechtsgesetzes legt ein äußerst wichtiges Prinzip fest, um den Missbrauch von Ausnahmeregelungen zu verhindern. Gemäß dieser Vorschrift wird die Verteilung oder öffentliche Präsentation einer legal erstellten Kopie eines Werkes für einen anderen als den ursprünglich vorgesehenen Zweck als Urheberrechtsverletzung angesehen. Dies wird als “angenommene Verletzung” bezeichnet.
Beispielsweise wäre es eine Urheberrechtsverletzung, wenn ein Video einer Fernsehsendung, das für den privaten Gebrauch (gemäß Artikel 30 des japanischen Urheberrechtsgesetzes) und ausschließlich für den Hausgebrauch aufgezeichnet wurde, in einem Gemeindezentrum gezeigt oder ins Internet hochgeladen wird. Ebenso ist es nicht gestattet, eine Kopie einer Software, die zu Backup-Zwecken (gemäß Artikel 47 Absatz 3) erstellt wurde, an andere Mitarbeiter zu verteilen oder auf nicht autorisierten Computern zu installieren.
Diese Bestimmung soll sicherstellen, dass die Ausnahmen von Urheberrechten nur für bestimmte gemeinnützige oder private Zwecke gewährt werden und nicht als Schlupfloch für kommerzielle Ausbeutung oder unbegrenzte Nutzung missbraucht werden.
Die Beziehung zu den Urheberpersönlichkeitsrechten (Artikel 50)
Um das japanische Urheberrecht zu verstehen, ist es unerlässlich, zwischen dem “Urheberrecht” als vermögensrechtlichem Recht und den “Urheberpersönlichkeitsrechten” als ausschließlich persönlichen Rechten, die die persönlichen Interessen des Urhebers schützen, klar zu unterscheiden. Zu den Urheberpersönlichkeitsrechten gehören die folgenden drei Hauptrechte:
- Veröffentlichungsrecht: Das Recht zu entscheiden, wann und wie ein unveröffentlichtes Werk veröffentlicht wird
- Namensnennungsrecht: Das Recht zu entscheiden, ob und unter welchem Namen der Urheber genannt wird
- Recht auf Werkintegrität: Das Recht, Veränderungen am Inhalt oder Titel des eigenen Werks gegen den Willen des Urhebers zu verhindern
Artikel 50 des japanischen Urheberrechtsgesetzes legt klar fest, dass die bisher erwähnten Einschränkungen des Urheberrechts (Vermögensrechte) nicht so interpretiert werden dürfen, dass sie diese Urheberpersönlichkeitsrechte beeinträchtigen. Dies fungiert gewissermaßen als “Schutzwall der Urheberpersönlichkeitsrechte”.
Dieses Prinzip kann insbesondere für ausländische Unternehmen, die an flexible Rechtssysteme wie den Fair Use in den USA gewöhnt sind, ein erhebliches rechtliches Risiko darstellen. Selbst wenn die Nutzung eines Werks zu Bildungszwecken durch die Einschränkungen des Urheberrechts erlaubt sein mag, kann das Zusammenfassen oder Ausschneiden von Teilen des Werks bei dieser Nutzung die Rechte auf Werkintegrität des Urhebers verletzen.
Die deutlichste Darstellung dieses Rechtsgrundsatzes erfolgte im nachfolgend beschriebenen “Parodie-Montagefoto-Fall”. In diesem Fall wurde eine kreative Veränderung mit kritischer Absicht (Parodie) als illegal angesehen, weil sie das Recht auf Werkintegrität des Urhebers verletzte. Daher ist bei der möglichen Veränderung von Werken Dritter, selbst wenn die Nutzung unter die Einschränkungen des Urheberrechts zu fallen scheint, eine vorsichtige Vorgehensweise erforderlich, wie zum Beispiel die Einholung einer Vereinbarung vom Urheber, dass er seine Urheberpersönlichkeitsrechte nicht ausübt.
Konzeptioneller Rahmen: Fair Use und Parodie in Japan
Es ist wichtig, nicht nur die einzelnen Regeln zu verstehen, sondern auch die ideologische Grundlage des japanischen Urheberrechtsgesetzes zu erfassen, um komplexere Nutzungsformen zu betrachten. In diesem Zusammenhang werden wir die Besonderheiten des japanischen Rechtssystems im Vergleich zum Fair-Use-System der USA beleuchten und erläutern, wie kreative Nutzungen wie Parodien behandelt werden.
Der „Enumerationsprinzip“ unter japanischem Recht und Fair Use
Das japanische Urheberrechtsgesetz folgt dem legislativen Ansatz des „Enumerationsprinzips“, bei dem Fälle, in denen Rechte eingeschränkt werden, spezifisch und umfassend im Gesetzestext aufgelistet sind. Dies bedeutet, dass jede Nutzungsmethode, die nicht in der Liste aufgeführt ist, grundsätzlich als Urheberrechtsverletzung gilt. Dieser Ansatz bietet den Vorteil einer hohen Vorhersehbarkeit darüber, was legal und was illegal ist. Unternehmen können das rechtliche Risiko klar bewerten, indem sie überprüfen, ob ihre Handlungen den Anforderungen der Gesetzestexte entsprechen.
Im Gegensatz dazu ist der „Fair Use“, wie er im amerikanischen Urheberrecht angewendet wird, ein umfassendes und flexibles Rechtsprinzip. Anstatt einzelne Ausnahmen aufzulisten, berücksichtigt das Gericht vier Faktoren – „Zweck und Charakter der Nutzung“, „Natur des urheberrechtlich geschützten Werks“, „Menge und Wesentlichkeit des genutzten Teils“ und „Auswirkung der Nutzung auf den potenziellen Markt oder Wert des Werks“ – und entscheidet auf einer Fall-zu-Fall-Basis, ob die Nutzung fair ist. Dieses System bietet Flexibilität, um schnell auf neue Technologien und Ausdrucksformen zu reagieren, birgt jedoch auch die Schwierigkeit, das Ergebnis vorherzusagen, und erhöht das Risiko von Rechtsstreitigkeiten.
Die geschäftlichen Implikationen beider Systeme können wie in der folgenden Tabelle zusammengefasst werden:
| Merkmale | Enumerationsprinzip in Japan | Fair Use in den USA |
|---|---|---|
| Rechtliche Grundlage | Konkret im Gesetz aufgelistete Ausnahmeregelungen (Artikel 30 bis 50 usw.) | Vom Gericht angewandte umfassende Kriterien der vier Faktoren |
| Vorhersehbarkeit | Hoch. Es wird anhand der Entsprechung mit den Gesetzestexten geurteilt. | Niedrig. Abhängig von der nachträglichen Gesamtbewertung durch das Gericht. |
| Flexibilität | Niedrig. Anpassungen an neue Technologien erfordern Gesetzesänderungen. | Hoch. Neue Nutzungsformen können durch Interpretation angewendet werden. |
| Prozessrisiko | Niedrig, wenn die Handlung eindeutig den Gesetzestexten entspricht. | Hoch, da oft strittig ist, ob die Nutzung fair ist, was das Prozessrisiko erhöht. |
| Unternehmensreaktion | Der Schwerpunkt liegt auf einer strengen Interpretation und Einhaltung des Gesetzestextes. | Der Schwerpunkt liegt auf der Analyse der vier Faktoren und Rechtsprechung sowie der Bewertung des Risikos. |
Flexible Urheberrechtseinschränkungen in Japan: Nutzung ohne den Zweck des Genusses von Gedanken oder Gefühlen (Artikel 30-4)
Um die Starrheit des Enumerationsprinzips zu mildern und technologischen Innovationen gerecht zu werden, wurde im Jahr 2018 (Heisei 30) eine Änderung des japanischen Urheberrechtsgesetzes vorgenommen, die Artikel 30-4 einführte. Diese Bestimmung wird oft als “japanische Version des Fair Use” bezeichnet, allerdings ist ihr Anwendungsbereich begrenzt.
Der Artikel erlaubt die Nutzung von urheberrechtlich geschützten Werken, sofern sie nicht dem Zweck dienen, Gedanken oder Gefühle zu genießen, sondern in einem notwendigen und anerkannten Umfang. Dies betrifft die Verwendung von Werken nicht zur Betrachtung, sondern als “Daten” für Informationsanalysen oder technologische Entwicklungsversuche. Ein Beispiel hierfür wäre das Sammeln großer Mengen von Bildern oder Texten, um Muster zu analysieren und neue Technologien zu entwickeln.
Dennoch ist dieses Recht nicht unbegrenzt. Es gibt eine Einschränkung, dass es nicht angewendet werden darf, “wenn es die Interessen des Urheberrechtsinhabers ungerechtfertigt beeinträchtigt”. Zum Beispiel ist die Nutzung einer Datenbank, die für Informationsanalysen verkauft wird, ohne Lizenzvertrag, und die somit direkt mit dem Markt konkurriert, den der Urheberrechtsinhaber bedienen sollte, wahrscheinlich nicht gestattet, da sie die Interessen des Urheberrechtsinhabers ungerechtfertigt beeinträchtigen könnte.
Rechtliche Herausforderungen bei Parodien unter japanischem Urheberrecht
Im japanischen Urheberrecht gibt es keine spezielle Regelung, die Parodien ausdrücklich erlaubt. Daher wird die Rechtmäßigkeit von Parodiewerken innerhalb des bestehenden Rahmens des Urheberrechts beurteilt, insbesondere in Bezug auf das Recht der Bearbeitung (das Recht, ein Werk zu ändern und ein abgeleitetes Werk zu schaffen) und das bereits erwähnte Recht auf Wahrung der Werkintegrität (ein Teil des Urheberpersönlichkeitsrechts).
Ein wegweisendes Urteil in dieser Hinsicht ist das Urteil des Obersten Gerichtshofs von 1980, bekannt als der “Parodie-Montagefoto-Fall”. In diesem Fall ging es um ein Werk, bei dem ein bekanntes Skifoto in Schwarzweiß umgewandelt und mit dem Bild eines riesigen Reifens überlagert wurde, um die Zerstörung der Natur zu satirisieren. Der Oberste Gerichtshof entschied, dass dieses Parodiewerk eine Urheberrechtsverletzung darstellt. Der Kern der Argumentation lag darin, dass das veränderte Werk immer noch die “wesentlichen charakteristischen Merkmale der Ausdrucksform” des Originalfotos direkt erkennen ließ. Mit anderen Worten, die Zuschauer konnten sich das Originalwerk leicht ins Gedächtnis rufen, und die unbefugte Änderung verletzte das Recht des Urhebers auf Wahrung der Werkintegrität. Dieses Urteil zeigte, dass Parodien, die den Ausdruck des Originalwerks direkt ändern, selbst wenn sie mit der Absicht der Kritik oder Satire erstellt wurden, unter dem japanischen Rechtssystem ein sehr hohes rechtliches Risiko bergen.
Andererseits gibt es auch Urteile, die einen sichereren Weg für parodistische Kreativität aufzeigen. Im Urteil des Obersten Gerichtshofs von 2001, bekannt als der “Esashi Oiwake-Fall”, wurde die Herstellung einer Fernsehsendung unter Verwendung historischer Fakten und Ideen aus einem Sachbuch angefochten. Der Oberste Gerichtshof stellte klar, dass das Urheberrecht den konkreten “Ausdruck” schützt, nicht jedoch die zugrunde liegenden “Ideen” oder “Fakten”, was die “Idee-Ausdruck-Dichotomie” verdeutlicht. Aus diesem Urteil lässt sich ableiten, dass eine Parodie, die nicht den Ausdruck eines Werkes direkt ändert, sondern Themen, Stile oder Ideen eines Werkes satirisch darstellt und in einer völlig neuen, eigenständigen Ausdrucksform schafft, weniger wahrscheinlich eine Urheberrechtsverletzung darstellt.
Zusammenfassung
Die Bestimmungen zur Beschränkung von Rechten im japanischen Urheberrechtsgesetz basieren auf einem strengen Enumerationsprinzip und bieten einen klaren und vorhersehbaren rechtlichen Rahmen. Wenn Unternehmen diese Ausnahmeregelungen in der Praxis nutzen, müssen sie nicht nur die Anforderungen der einzelnen Artikel genau prüfen, sondern auch die grundlegenden Prinzipien wie die Pflicht zur Quellenangabe (Artikel 48), das Verbot der Nutzung außerhalb des vorgesehenen Zwecks (Artikel 49) und vor allem das “Urheberpersönlichkeitsrecht” (Artikel 50), das nicht durch Beschränkungen des Eigentumsrechts beeinträchtigt wird, stets berücksichtigen. Insbesondere der Schutz des Urheberpersönlichkeitsrechts ist sehr stark und stellt ein wichtiges Risiko dar, das sich von ausländischen Rechtssystemen unterscheidet. Die strenge Rechtsprechung zu Parodien und die begrenzte Flexibilisierung, um technologischen Innovationen gerecht zu werden (Artikel 30-4), symbolisieren die Eigenschaften des japanischen Rechtssystems, das eine sorgfältige Balance zwischen dem Schutz der Rechte der Urheber und der Entwicklung der Kultur anstrebt.
Die Monolith Rechtsanwaltskanzlei verfügt über umfangreiche Beratungserfahrung in Bezug auf die komplexen Fragen der Urheberrechtsbeschränkungen, die in diesem Artikel erläutert wurden, und bedient eine Vielzahl von in- und ausländischen Mandanten. Unsere Kanzlei beschäftigt mehrere Experten, einschließlich englischsprachiger Fachkräfte mit ausländischen Anwaltszulassungen, die in der Lage sind, präzise rechtliche Unterstützung aus einer internationalen Geschäftsperspektive zu den einzigartigen Herausforderungen zu bieten, die das japanische Recht des geistigen Eigentums mit sich bringt. Wir bieten spezialisierte Unterstützung beim Aufbau von Compliance-Strukturen, bei der Verhandlung von Vertragsklauseln über den Verzicht auf Urheberpersönlichkeitsrechte und bei anderen strategischen Beratungen im Bereich des Urheberrechts.
Category: General Corporate