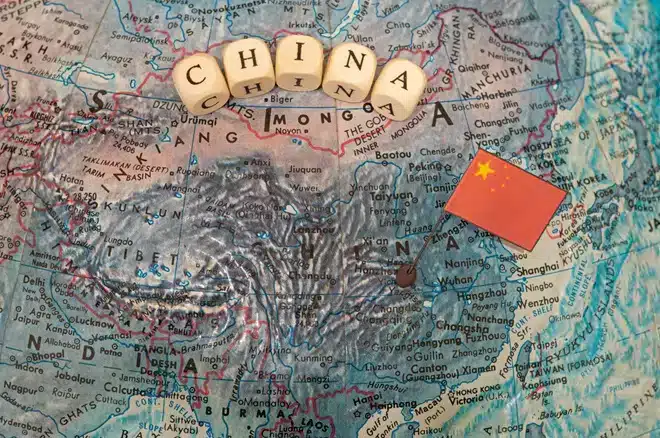Verletzungen des Urheberrechts in Japan und zivilrechtliche Abhilfemaßnahmen: Unterlassung, Schadensersatz und Rückgabe ungerechtfertigter Bereicherung

Im globalen Geschäftsumfeld stellt der Schutz von geistigem Eigentum, insbesondere von Urheberrechten, ein strategisches Element dar, das entscheidend für die Aufrechterhaltung der Wettbewerbsfähigkeit und des Vermögenswertes eines Unternehmens ist. Wenn Sie in Japan Geschäfte tätigen oder mit japanischen Kreativen und Unternehmen zusammenarbeiten, ist es unerlässlich, genau zu verstehen, wie das japanische Urheberrecht funktioniert – nicht nur im Hinblick auf Compliance, sondern auch aus Perspektiven des Risikomanagements und der Vermögensnutzung. Was können Rechteinhaber tun, wenn ihre Werke ohne Erlaubnis genutzt werden? Das japanische Recht bietet zum Schutz der Interessen der Rechteinhaber starke und vielseitige Rechtsmittel. In diesem Artikel erläutern wir aus fachlicher Sicht detailliert die Voraussetzungen für eine Urheberrechtsverletzung nach japanischem Recht und die wichtigsten zivilrechtlichen Abhilfemaßnahmen, die Rechteinhabern zur Verfügung stehen: Unterlassungsansprüche, Schadensersatzforderungen und Ansprüche auf Herausgabe ungerechtfertigter Bereicherung, basierend auf konkreten Gesetzestexten und Gerichtsentscheidungen. Das Verständnis dieser rechtlichen Rahmenbedingungen wird eine solide Richtlinie sein, um Ihre eigenen Urheberrechte zu schützen und die Rechte anderer zu respektieren.
Voraussetzungen für das Vorliegen einer Urheberrechtsverletzung nach japanischem Recht
Ob eine Urheberrechtsverletzung rechtlich besteht, wird nicht aufgrund subjektiver Eindrücke, sondern anhand objektiver Kriterien gemäß dem japanischen Urheberrechtsgesetz beurteilt. Damit eine Handlung als Urheberrechtsverletzung angesehen wird, müssen hauptsächlich drei Voraussetzungen erfüllt sein: “Werkqualität”, “Abhängigkeit” und “Ähnlichkeit”. Diese Kriterien spielen eine wichtige Rolle dabei, den Schutzbereich der Rechte abzugrenzen und gleichzeitig die Freiheit kreativer Tätigkeiten nicht ungerechtfertigt einzuschränken.
Werkcharakter nach japanischem Urheberrecht
Um einen Urheberrechtsverstoß geltend zu machen, muss das zu schützende Werk gemäß Artikel 2 Absatz 1 Nummer 1 des japanischen Urheberrechtsgesetzes als “Werk” qualifiziert sein. Das Gesetz definiert ein Werk als “eine kreative Ausdrucksform von Gedanken oder Gefühlen, die zum Bereich der Literatur, Wissenschaft, Kunst oder Musik gehört”. Aus dieser Definition geht hervor, dass “Kreativität” für die Anerkennung als Werk unerlässlich ist.
Die hier geforderte “Kreativität” verlangt jedoch nicht notwendigerweise ein hohes Maß an künstlerischer Qualität oder Originalität. Es reicht aus, wenn irgendeine Form der Individualität des Autors zum Ausdruck kommt, und die Kriterien für diese Beurteilung sind relativ locker. Dennoch wird Dingen, die von jedermann auf die gleiche Weise ausgedrückt werden könnten, oder bloßen Fakten und Daten selbst, keine Kreativität zugesprochen. Beispielsweise werden Fotos eines Taifuns, die von einem Wettersatelliten mechanisch aufgenommen wurden, da sie keine kreative menschliche Beteiligung aufweisen, grundsätzlich nicht als Werke angesehen. Daher entsteht kein Urheberrechtsproblem, wenn solche Fotos von anderen verwendet werden. In der Unternehmenspraxis ist das Vorhandensein oder Fehlen dieser “Kreativität” der erste wichtige Entscheidungspunkt bei der Beurteilung, ob selbst generierte Daten oder Berichte schutzfähig sind oder nicht.
Abhängigkeit
Das zweite Erfordernis ist die “Abhängigkeit”. Dies bedeutet, dass ein neues Werk auf der Grundlage eines fremden Urheberwerks (vorangegangenes Urheberwerk) erstellt wurde und von diesem abhängt. Selbst wenn die beiden Werke zufällig sehr ähnlich sind, liegt keine Urheberrechtsverletzung vor, wenn das spätere Werk unabhängig und ohne Kenntnis des vorangegangenen Urheberwerks geschaffen wurde. Dieses Prinzip dient dazu, kreative Aktivitäten vor Behinderungen durch zufällige Übereinstimmungen zu schützen.
Das Konzept der Abhängigkeit wurde in der japanischen Rechtsprechung durch das Urteil des Obersten Gerichtshofs von Japan (1978 (Showa 53) am 7. September) im Fall, der gemeinhin als “One Rainy Night in Tokyo” bekannt ist, etabliert. In diesem Urteil stellte der Oberste Gerichtshof fest, dass die “Vervielfältigung” im Sinne des Urheberrechtsgesetzes das “Reproduzieren eines bestehenden Urheberwerks in einer Weise, die dessen Inhalt und Form erkennbar macht”, bedeutet. Dadurch wurde klargestellt, dass, wenn jemand, der keine Gelegenheit hatte, mit einem bestehenden Urheberwerk in Berührung zu kommen und dessen Existenz oder Inhalt nicht kannte, ein Werk mit Identität zum Original schafft, dies nicht als “Vervielfältigung” gilt und somit keine Urheberrechtsverletzung darstellt.
Im Prozessalltag ist es jedoch schwierig, die Abhängigkeit direkt zu beweisen, wenn die beschuldigte Seite behauptet, sie habe das Werk eigenständig geschaffen. Der Grund dafür ist, dass die Abhängigkeit eine Frage des inneren Zustands während des Schaffensprozesses ist. Daher neigen Gerichte dazu, die Abhängigkeit indirekt zu erschließen, indem sie prüfen, ob der Autor des späteren Werks Gelegenheit hatte, mit dem vorangegangenen Urheberwerk in Berührung zu kommen (Möglichkeit des Zugangs) und in welchem Maße Ähnlichkeiten zwischen den Werken bestehen. Insbesondere wenn die Ausdrucksweise komplex ist oder in ungewöhnlichen Teilen Gemeinsamkeiten festgestellt werden, neigt die Abhängigkeit dazu, stark angenommen zu werden. Dies unterstreicht die Bedeutung für Unternehmen, Entwürfe, Referenzmaterialien und Entwicklungsunterlagen angemessen zu archivieren, um die Legitimität ihres kreativen Prozesses zu belegen.
Ähnlichkeit
Das dritte Kriterium ist, dass das abgeleitete Werk dem vorangegangenen Originalwerk “ähnlich” sein muss. Eine bloße Ähnlichkeit in Ideen oder Konzepten stellt keinen Urheberrechtsverstoß dar. Das japanische Urheberrecht schützt die konkrete “Ausdrucksform”, nicht die zugrunde liegende Idee.
Als Maßstab dafür, ob eine Ähnlichkeit anerkannt wird oder nicht, hat der Oberste Gerichtshof Japans das Kriterium aufgestellt, ob “die wesentlichen Merkmale des Ausdrucks direkt wahrgenommen werden können”. Dies bedeutet, dass eine Person, die mit dem späteren Werk in Berührung kommt, direkt die wesentlichen Merkmale der Ausdrucksform des vorangegangenen Originalwerks wahrnehmen kann, also die Teile, in denen die Individualität des Urhebers am stärksten zum Ausdruck kommt.
Daher wird, selbst wenn es gemeinsame Elemente zwischen zwei Werken gibt, die Ähnlichkeit verneint, wenn diese Elemente alltägliche Ausdrucksformen sind, die jeder einfallen könnten (wie zum Beispiel die typische Darstellung eines bestimmten Tieres). In einem Fall, der vom Bezirksgericht Tokio am 30. März 2022 (Frühlingsrollen-Anrichtefoto-Fall) entschieden wurde, wurde festgestellt, dass die Gemeinsamkeiten in der Komposition und Anordnung der auf einem Teller angerichteten Frühlingsrollen innerhalb des Bereichs alltäglicher Ausdrucksformen liegen und somit kein Urheberrechtsverstoß vorlag. In einem anderen Fall wurde jedoch die Kreativität einer spezifischen Ausdrucksweise, wie die einzigartige Anordnung von Wassermelonen und die Farbgebung des Hintergrunds, anerkannt und die Ähnlichkeit aufgrund der gemeinsamen wesentlichen Merkmale bejaht.
Dieses Kriterium gibt Unternehmen Hinweise darauf, wo die rechtlichen Grenzen zu ziehen sind, wenn sie die Produkte oder Dienstleistungen von Wettbewerbern untersuchen und neue Produkte entwickeln, um auf die Marktnachfrage zu reagieren. Es mag erlaubt sein, sich von den zugrunde liegenden Ideen hinter dem Erfolg anderer inspirieren zu lassen, aber die Nachahmung der konkreten Ausdrucksformen, insbesondere der kreativen Aspekte, die ein Produkt charakterisieren, erhöht das Risiko eines Urheberrechtsverstoßes erheblich.
Zivilrechtliche Abhilfe bei Urheberrechtsverletzungen unter japanischem Recht
Das japanische Urheberrechtsgesetz sowie das Zivilgesetzbuch sehen mehrere zivilrechtliche Abhilfemaßnahmen vor, die Rechteinhaber im Falle einer Urheberrechtsverletzung ausüben können. Diese Abhilfemaßnahmen zielen darauf ab, die Verletzungshandlung zu stoppen, entstandene Schäden zu beheben und zukünftige Verletzungen zu verhindern. Zu den wichtigsten Maßnahmen gehören Unterlassungsansprüche, Schadensersatzforderungen und die Rückforderung ungerechtfertigter Bereicherung.
Unterlassungsanspruch nach japanischem Urheberrecht
Der Unterlassungsanspruch ist eines der direktesten und wirkungsvollsten Mittel zur Abhilfe bei Urheberrechtsverletzungen. Gemäß Artikel 112 Absatz 1 des japanischen Urheberrechtsgesetzes kann der Urheberrechtsinhaber von einer Person, die seine Rechte aktuell verletzt, die Einstellung dieser Verletzung und von einer Person, von der zu befürchten ist, dass sie in Zukunft eine Verletzung begehen könnte, die Verhinderung einer solchen Verletzung verlangen.
Ein wesentliches Merkmal dieses Anspruchs ist, dass es nicht notwendig ist, Vorsatz oder Fahrlässigkeit des Verletzers nachzuweisen. Es genügt der objektive Tatbestand, dass eine Verletzungshandlung vorliegt oder eine offensichtliche Gefahr dafür besteht, um einen Anspruch geltend zu machen. Dies ermöglicht es dem Rechteinhaber, ohne die subjektive Absicht des Verletzers zu hinterfragen, schnell eine Korrektur des Verletzungszustandes zu erreichen.
Darüber hinaus erlaubt Artikel 112 Absatz 2 des japanischen Urheberrechtsgesetzes zusätzliche Maßnahmen, um die Wirksamkeit des Unterlassungsanspruchs zu gewährleisten. Konkret kann der Rechteinhaber die Vernichtung von Gegenständen verlangen, die eine Verletzungshandlung darstellen (zum Beispiel Raubkopien von Büchern oder Software) oder die durch eine Verletzungshandlung hergestellt wurden (zum Beispiel unerlaubt vervielfältigte DVDs). In manchen Fällen kann auch die Vernichtung von Maschinen oder Geräten gefordert werden, die ausschließlich für die Verletzungshandlung verwendet wurden. Diese Bestimmung verleiht dem Rechteinhaber nicht nur die Macht, die Verletzungshandlung zu stoppen, sondern auch die Quelle der Verletzung physisch zu beseitigen und so eine Wiederholung in der Zukunft zu verhindern. Für Unternehmen ist es von äußerster Wichtigkeit, Nachahmungsprodukte vom Markt zurückzurufen und zu vernichten, um den Markenwert und den Marktanteil zu schützen.
Schadensersatzforderungen unter japanischem Recht
Wenn ein Rechteinhaber durch eine Urheberrechtsverletzung Schaden erleidet, kann er finanziellen Ausgleich fordern. Diese Schadensersatzforderung basiert auf den Bestimmungen über unerlaubte Handlungen gemäß Artikel 709 des japanischen Zivilgesetzbuches. Im Gegensatz zu Unterlassungsansprüchen muss der Rechteinhaber nachweisen, dass der Verletzer vorsätzlich oder fahrlässig gehandelt hat, um Schadensersatz zu fordern.
Jedoch ist es in vielen Fällen äußerst schwierig, den genauen Schadensbetrag bei Urheberrechtsverletzungen nachzuweisen. Es ist nicht einfach zu beweisen, wie viel Gewinn erzielt worden wäre, wenn die Verletzung nicht stattgefunden hätte. Um die Beweislast zu verringern, stellt Artikel 114 des japanischen Urheberrechtsgesetzes drei Vermutungsregeln zur Berechnung des Schadensbetrags auf. Der Rechteinhaber kann die für seinen Fall vorteilhafteste Regel auswählen und geltend machen.
- Artikel 114 Absatz 1: Diese Methode berechnet den Schadensbetrag, indem die Anzahl der vom Verletzer verkauften Produkte mit dem Gewinn pro Einheit des vom Rechteinhaber verkauften Originalprodukts multipliziert wird. Dies betrachtet die Verkaufschancen des Verletzers als entgangenen Gewinn, den der Rechteinhaber hätte erzielen können. Allerdings kann der Betrag aufgrund anderer Faktoren wie der Produktions- und Verkaufskapazität des Rechteinhabers oder der Geschäftsanstrengungen des Verletzers reduziert werden.
- Artikel 114 Absatz 2: Diese Methode schätzt den Schadensbetrag des Rechteinhabers anhand des Gewinns, den der Verletzer durch seine Verletzungshandlung erzielt hat. Nach dieser Bestimmung wird der Gewinn des Verletzers rechtlich als Schadensbetrag des Rechteinhabers angenommen, wenn dieser nachgewiesen wird. Da es sich jedoch nur um eine Vermutung handelt, kann der Verletzer durch Gegenbeweis, dass der tatsächliche Schaden des Rechteinhabers geringer ist, die Vermutung widerlegen.
- Artikel 114 Absatz 3: Diese Methode setzt den Schadensbetrag gleich dem Betrag, der einer Lizenzgebühr für die Nutzung des Werkes entspricht. Dies erlaubt es, den Betrag, den der Verletzer bei einer rechtmäßigen Lizenzierung hätte zahlen müssen, als Mindestschaden geltend zu machen. Selbst wenn der Nachweis des entgangenen Gewinns oder des Gewinns des Verletzers schwierig ist, kann der Schadensbetrag auf der Grundlage von branchenüblichen Lizenzgebühren berechnet werden, was in der Praxis häufig genutzt wird.
Diese Vermutungsregeln erleichtern die Beweisführung des Rechteinhabers erheblich und wirken sich vorteilhaft auf das Kräfteverhältnis in Gerichtsverfahren aus. In jüngsten Gerichtsentscheidungen wurden in Fällen von großangelegten Piraterie-Websites auf der Grundlage dieser Bestimmungen hohe Schadensersatzsummen zugesprochen.
Anspruch auf Rückforderung ungerechtfertigter Bereicherung nach japanischem Recht
Der Anspruch auf Rückforderung ungerechtfertigter Bereicherung ist ein finanzielles Rechtsmittel, das auf einer anderen rechtlichen Grundlage als der Schadensersatzforderung basiert. Es stützt sich auf die Artikel 703 und 704 des japanischen Zivilgesetzbuches und zielt darauf ab, von einer Person, die ohne rechtlichen Grund durch das Vermögen oder die Arbeit anderer einen Vorteil erlangt und dadurch anderen einen Verlust zugefügt hat, die Rückgabe dieses Vorteils zu verlangen.
Im Kontext von Urheberrechtsverletzungen kann der Rechteinhaber von dem Verletzer, der ohne die erforderliche Erlaubnis des Rechteinhabers und somit “ohne rechtlichen Grund” das urheberrechtlich geschützte Werk genutzt und daraus einen Vorteil gezogen hat, die Rückgabe dieses Vorteils fordern. Der größte Vorteil dieses Anspruchs besteht darin, dass im Gegensatz zur Schadensersatzforderung nicht nachgewiesen werden muss, dass der Verletzer vorsätzlich oder fahrlässig gehandelt hat. Es reicht aus, den Tatbestand der Verletzung und die objektive Tatsache, dass der Verletzer daraus einen Vorteil gezogen hat, zu beweisen.
Der Umfang der Rückforderung hängt von der subjektiven Erkenntnis des Verletzers ab. Wusste der Verletzer nicht, dass sein Handeln eine Urheberrechtsverletzung darstellt (im Falle von Gutgläubigkeit), so ist er nur zur Rückgabe des Vorteils verpflichtet, der ihm aktuell noch verbleibt (der sogenannte “Bestandteil des Vorteils”). Hat der Verletzer jedoch in Kenntnis der Verletzung seine Handlungen fortgesetzt (im Falle von Bösgläubigkeit), so ist er verpflichtet, den gesamten erlangten Vorteil zuzüglich der gesetzlichen Zinsen zurückzuzahlen.
Der Anspruch auf Rückforderung ungerechtfertigter Bereicherung spielt insbesondere in zwei Situationen eine wichtige Rolle. Die erste ist, wenn der Nachweis eines Verschuldens des Verletzers schwierig ist. Die zweite ist, wenn die Verjährungsfrist für Schadensersatzansprüche bereits abgelaufen ist. Auf diese Weise fungiert der Anspruch auf Rückforderung ungerechtfertigter Bereicherung als rechtliches “Sicherheitsnetz”, das die Schadensersatzforderung ergänzt und für den Rechteinhaber eine wichtige Option darstellt, um Rechtsbehelfe zu suchen.
Vergleich zwischen Schadensersatzforderungen und Forderungen auf Herausgabe von ungerechtfertigten Bereicherungen nach japanischem Recht
Sowohl Schadensersatzforderungen als auch Forderungen auf Herausgabe von ungerechtfertigten Bereicherungen zielen darauf ab, finanzielle Verluste auszugleichen. Sie haben jedoch wichtige Unterschiede in ihrer rechtlichen Natur, ihren Voraussetzungen und ihren Auswirkungen. Welche Art von Anspruch gewählt wird, sollte strategisch auf der Grundlage der spezifischen Umstände des Falles entschieden werden, insbesondere unter Berücksichtigung der subjektiven Haltung des Verletzers und des Zeitraums bis zur Entdeckung der Verletzung.
Schadensersatzforderungen konzentrieren sich darauf, den durch eine “unerlaubte Handlung” des Verletzers entstandenen “Schaden” des Rechteinhabers zu kompensieren. Daher ist Vorsatz oder Fahrlässigkeit des Verletzers eine notwendige Voraussetzung. Im Gegensatz dazu liegt der Schwerpunkt bei Forderungen auf Herausgabe von ungerechtfertigten Bereicherungen darauf, dem Verletzer einen “Gewinn”, den er “ohne rechtlichen Grund” erlangt hat, zu entziehen und das Prinzip der Fairness zu verwirklichen, ohne die Absicht oder Fahrlässigkeit des Verletzers zu berücksichtigen.
Des Weiteren unterscheiden sich die beiden Ansprüche in der Frist für die Verjährung. Nach dem japanischen Zivilgesetzbuch erlischt das Recht auf Schadensersatz aufgrund unerlaubter Handlungen drei Jahre nachdem der Geschädigte den Schaden und den Schädiger kennt oder zwanzig Jahre nach der unerlaubten Handlung (letzteres wird als Ausschlussfrist verstanden). Andererseits erlischt das Recht auf Herausgabe von ungerechtfertigten Bereicherungen fünf Jahre nach Kenntnis der Möglichkeit, dieses Recht auszuüben, oder zehn Jahre nach dem Zeitpunkt, zu dem das Recht ausgeübt werden konnte. Daher besteht die Möglichkeit, dass das Recht auf Herausgabe von ungerechtfertigten Bereicherungen ausgeübt werden kann, auch wenn das Recht auf Schadensersatz aufgrund der Verjährung erloschen ist, wenn mehr als drei Jahre seit Kenntnis der Verletzung vergangen sind.
Die Unterschiede lassen sich wie folgt zusammenfassen:
| Merkmale | Schadensersatzforderung | Forderung auf Herausgabe von ungerechtfertigten Bereicherungen |
| Rechtsgrundlage | Artikel 709 des japanischen Zivilgesetzbuches, Artikel 114 des japanischen Urheberrechtsgesetzes | Artikel 703, 704 des japanischen Zivilgesetzbuches |
| Notwendigkeit von Vorsatz oder Fahrlässigkeit | Erforderlich | Nicht erforderlich |
| Verjährungsfrist | 3 Jahre ab Kenntnis von Schaden und Schädiger, 20 Jahre ab der unerlaubten Handlung (Ausschlussfrist) | 5 Jahre ab Kenntnis der Möglichkeit zur Ausübung des Rechts, 10 Jahre ab dem Zeitpunkt, zu dem das Recht ausgeübt werden konnte |
| Rückzahlungs-/Entschädigungsumfang | Der entstandene Schadensbetrag (mit Vermutungsregelung im Urheberrechtsgesetz) | Der ungerechtfertigt erlangte Gewinn (bei Gutgläubigkeit beschränkt auf den noch vorhandenen Gewinn) |
Zusammenfassung
Wie in diesem Artikel dargelegt, legt das japanische Urheberrechtsgesetz die Voraussetzungen für Urheberrechtsverletzungen klar fest und bietet starke zivilrechtliche Abhilfemaßnahmen zum Schutz der Rechte der Urheber. Unterlassungsansprüche, die darauf abzielen, Verletzungshandlungen schnell zu stoppen, sowie Schadensersatz- und ungerechtfertigte Bereicherungsansprüche, die finanzielle Wiedergutmachung suchen, sind wichtige rechtliche Werkzeuge für Rechteinhaber mit jeweils unterschiedlichen Anforderungen und Wirkungen. Ein tiefes Verständnis dieser Systeme und ihre angemessene Nutzung je nach Situation sind unerlässlich für die Durchführung einer effektiven geistigen Eigentumsstrategie eines Unternehmens.
Die Monolith Rechtsanwaltskanzlei verfügt über umfangreiche Erfahrungen in der Vertretung einer Vielzahl von in- und ausländischen Mandanten im Bereich des geistigen Eigentums, einschließlich des Urheberrechts. Unser Team besteht nicht nur aus Anwälten, die mit dem japanischen Rechtssystem vertraut sind, sondern auch aus mehreren Experten, die als englischsprachige Anwälte mit ausländischen Anwaltszulassungen qualifiziert sind und somit in der Lage sind, präzise auf komplexe Urheberrechtsfragen im internationalen Geschäftskontext zu reagieren. Wir bieten umfassende rechtliche Unterstützung, die auf die Bedürfnisse Ihres Unternehmens zugeschnitten ist, einschließlich Beratung zu Urheberrechtsverletzungen, Rechtsdurchsetzung und Bewertung von Verletzungsrisiken.
Category: General Corporate