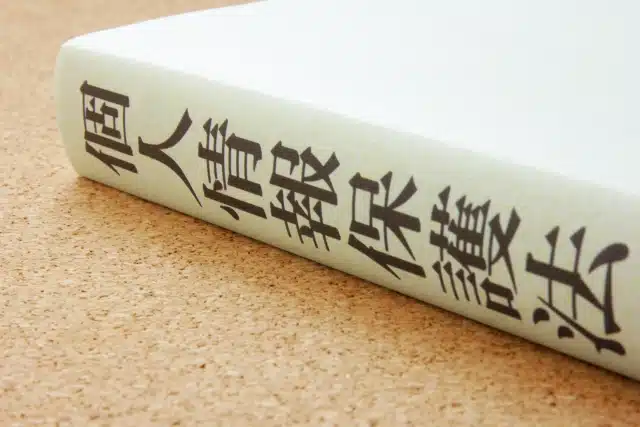Die Definition von "Werk" im japanischen Urheberrecht: Eine Erläuterung durch Gerichtsfälle

In der intellektuellen Eigentumsstrategie eines Unternehmens ist es ein äußerst wichtiger erster Schritt, genau zu identifizieren, ob das von der Firma selbst geschaffene Gut rechtlich geschützt ist oder nicht. Im japanischen Urheberrechtssystem ist der Ausgangspunkt dieses Schutzes das Konzept des “Werkes”. Wenn etwas nicht als “Werk” anerkannt wird, entsteht kein Urheberrechtsschutz. Daher ist es für das Risikomanagement und die Vermögensnutzung unerlässlich zu verstehen, ob die verschiedenen Ergebnisse der Geschäftstätigkeit, wie Produkt-Designs, Marketingmaterialien, Software und Inhalte von Webseiten, unter dieses “Werk” fallen. Artikel 2 Absatz 1 Nummer 1 des japanischen Urheberrechtsgesetzes definiert “Werke” als “Schöpfungen, die Gedanken oder Gefühle kreativ ausdrücken und die zu den Bereichen Literatur, Wissenschaft, Kunst oder Musik gehören”. Diese auf den ersten Blick abstrakte Definition wird durch die Urteile der Gerichte in konkreten Fällen klarer. Das japanische Rechtssystem zeichnet sich dadurch aus, dass die Gerichte allgemeine Definitionen, die in den Gesetzbüchern festgelegt sind, auf einzelne Fälle anwenden und interpretieren, um sie zu konkretisieren. Daher ist es unerlässlich, die bisherigen Gerichtsentscheidungen zu analysieren, um die Definition eines Werkes wirklich zu verstehen. In diesem Artikel werden wir die Definition eines Werkes in ihre vier Bestandteile zerlegen, nämlich die Darstellung von “Gedanken oder Gefühlen”, das Vorhandensein von “Kreativität”, das “Ausgedrücktsein” und die Zugehörigkeit zum Bereich der “Literatur, Wissenschaft, Kunst oder Musik”, und wir werden detailliert erklären, wie jedes dieser Elemente in der tatsächlichen Geschäftswelt interpretiert wurde, basierend auf einer Fülle von Gerichtsentscheidungen.
Die rechtliche Definition eines “Werkes” im japanischen Urheberrecht
Das japanische Urheberrecht definiert das zentrale Schutzobjekt “Werk” in Artikel 2, Absatz 1, Nummer 1 wie folgt:
Es handelt sich um eine kreative Ausdrucksform von Gedanken oder Gefühlen, die zum Bereich der Literatur, Wissenschaft, Kunst oder Musik gehört.
Diese Definition umfasst vier grundlegende Anforderungen, die erfüllt sein müssen, damit ein kreatives Produkt als Werk im Sinne des Urheberrechts anerkannt und geschützt wird. Die vier Anforderungen sind:
- Inhaltlich muss es sich um “Gedanken oder Gefühle” handeln
- Es muss “kreativ” sein
- Es muss “ausgedrückt” worden sein
- Es muss zum Bereich der “Literatur, Wissenschaft, Kunst oder Musik” gehören
Im Folgenden werden wir diese einzelnen Anforderungen näher betrachten und anhand konkreter Fälle erörtern, nach welchen Kriterien die Gerichte in Japan entschieden haben.
「Gedanken oder Gefühle」— Das Produkt menschlicher Geistestätigkeit
Das erste Erfordernis eines urheberrechtlich geschützten Werkes ist, dass es menschliche „Gedanken oder Gefühle“ beinhaltet. Dieses Kriterium verlangt, dass das Werk aus der geistigen Aktivität des Menschen hervorgegangen ist und schließt bloße Fakten, Daten oder rein funktionale Gesetzmäßigkeiten vom Urheberrechtsschutz aus.
Es fungiert als eine Art ‘Türsteher’, der unterschiedliche geistige Eigentumsrechte den angemessenen rechtlichen Systemen zuweist. Kreative Ausdrücke von Gedanken und Gefühlen fallen unter das Urheberrecht, technische Erfindungen unter das Patentrecht, Designs von Industrieprodukten unter das Designrecht und bloße Daten wie Kundenlisten können als Geschäftsgeheimnisse durch Verträge oder das Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb geschützt sein. Das Verständnis dieser Unterscheidung ist äußerst wichtig, um eine Strategie für den Schutz des geistigen Eigentums eines Unternehmens zu entwickeln.
In der Rechtsprechung wird diese Grenze ebenfalls streng beurteilt. Beispielsweise bestimmt Artikel 10 Absatz 2 des japanischen Urheberrechtsgesetzes, dass „einfache Nachrichtenübermittlung und Berichterstattung über aktuelle Ereignisse“ nicht als urheberrechtlich geschützte Werke gelten. Daraus folgt, dass bloße Daten oder eine Aufzählung von Fakten nicht als Werke anerkannt werden, sofern sie nicht mit den Gedanken oder Gefühlen des Autors verbunden sind.
Ebenso neigt die Rechtsprechung dazu, Dokumente, deren Ausdruck vollständig durch praktische Zwecke bestimmt wird und die keinen Raum für die Individualität des Autors lassen, als nicht diesem Erfordernis entsprechend zu beurteilen. So hat das Bezirksgericht Tokio in einem Urteil vom 14. Mai 1987 (Showa 62) die Urheberrechtlichkeit eines standardisierten Grundstückskaufvertrags verneint. In einem weiteren Urteil vom 31. August 1965 (Showa 40) traf das Bezirksgericht Tokio eine ähnliche Entscheidung bezüglich eines Konnossements. Die Formulierungen dieser Dokumente wurden aufgrund praktischer Anforderungen wie der Sicherheit und Effizienz von Transaktionen standardisiert und nicht als Ausdruck der Gedanken oder Gefühle des Verfassers angesehen.
Andererseits kann auch ein akademischer Inhalt als urheberrechtlich geschütztes Werk anerkannt werden, wenn die Gedanken oder Gefühle des Autors darin zum Ausdruck kommen. Das Bezirksgericht Tokio bestätigte in einem Urteil vom 21. Juni 1978 (Showa 53) die Urheberrechtlichkeit eines Artikels über das Sonnenlichtrecht, da es die Gedanken des Autors zum Thema Sonnenlicht kreativ zum Ausdruck brachte. So wird selbst bei wissenschaftlichen oder technischen Themen der Inhalt, die Analyse und die Art der Erklärung durch die intellektuelle Aktivität des Autors, also seine „Gedanken“, reflektiert und somit als urheberrechtlich geschütztes Werk anerkannt.
「Kreativität」— Der Ausdruck der Individualität des Urhebers
Das zweite erforderliche Kriterium, die “Kreativität”, verlangt im japanischen Urheberrechtsgesetz nicht notwendigerweise eine hohe künstlerische Qualität, Neuheit oder Originalität. Hier wird vielmehr gefordert, dass irgendeine Form der “Individualität” des Urhebers zum Ausdruck kommt. Das bedeutet, dass, wenn der Urheber bei der Ausführung seiner Darstellung eine Auswahlmöglichkeit hat und das Ergebnis dieser Auswahl die individuellen Merkmale des Urhebers widerspiegelt, die Anforderung an die Kreativität als erfüllt gilt.
Die Existenz von “Kreativität” wird aus der Perspektive beurteilt, wie viel Freiheit der Urheber in seiner Ausdrucksweise hat. Wenn die Art der Darstellung durch Funktion, Medium oder Thema stark eingeschränkt ist, wird es schwierig, Individualität zu zeigen, und die Eigenschaft als Werk wird leicht verneint. Im Gegensatz dazu wird Kreativität leichter anerkannt, wenn es viele Optionen für Auswahl, Anordnung und Wortwahl gibt.
Als Beispiel für anerkannte Kreativität kann man Werke wie Karten anführen. Das Urteil des Bezirksgerichts Tokio vom 27. Mai 2022 (Reiwa 4) hat die Werkqualität einer Wohngebietskarte bestätigt. Das Gericht entschied, dass die Auswahl der zu veröffentlichenden Informationen, wie die Namen von Gebäuden oder Bewohnern, Illustrationen von Einrichtungsorten und die Art und Weise, wie diese Informationen für eine einfache Suche und gute Lesbarkeit angeordnet und dargestellt werden, die Individualität des Urhebers widerspiegeln.
Ähnlich wird auch bei Datenbanken verfahren. Im Urteil des “Townpage-Datenbank-Falls” vom 17. März 2000 (Heisei 12) des Bezirksgerichts Tokio wurde nicht die Individualität der einzelnen Telefonnummerninformationen, sondern die Kreativität des “Berufsklassifikationssystems” selbst, in dem diese Informationen für die Suchbequemlichkeit in einer einzigartigen hierarchischen Struktur klassifiziert wurden, anerkannt und als Werk geschützt. Im Gegensatz dazu wurde einem Telefonbuch (Hello Pages), das lediglich in alphabetischer Reihenfolge angeordnet ist, diese Art von systematischer Struktur und damit Kreativität nicht zugesprochen.
Auch im Bereich der Computerprogramme wird eine ähnliche Beurteilung vorgenommen. Das Urteil des Bezirksgerichts Osaka vom 29. Januar 2024 (Reiwa 6) bestätigte die Werkqualität mehrerer Programme, die zwar in einer standardisierten Programmiersprache verfasst waren, aber aufgrund des konkreten Designs der Datenverarbeitung und der Struktur des gesamten, hunderte Seiten umfassenden Quellcodes, hatte der Urheber eine erhebliche “Auswahlbreite”, und als Ergebnis kam seine Individualität zum Ausdruck.
Andererseits wird Kreativität verneint, wenn der Ausdruck alltäglich ist. Im Urteil des Bezirksgerichts Tokio vom 30. März 2022 (Reiwa 4) im “Stick-Springroll-Fall” wurde entschieden, dass die Fototechniken zur appetitlichen Darstellung von Frühlingsrollen, wie Beleuchtung, Winkel und Anrichtung, allesamt alltägliche Ausdrucksformen in der kommerziellen Fotografie sind und somit die Kreativität des Fotos verneint wurde.
Kurze Slogans werden ebenfalls oft aufgrund der geringen Auswahl an Ausdrucksmöglichkeiten als nicht kreativ eingestuft. Im Urteil des Obersten Gerichtshofs für geistiges Eigentum vom 10. November 2015 (Heisei 27) wurde der Slogan eines Englischlernprogramms “Einfach Englisch hören, wie Musik” als kurz und beschreibend angesehen, mit sehr begrenzten Ausdrucksmöglichkeiten, und daher ohne Kreativität. Im Gegensatz dazu wurde im Fall des Verkehrssicherheitsslogans “Ich fühle mich sicher, sicherer als auf Mamas Schoß, im Kindersitz” die Kreativität aufgrund der einzigartigen Perspektive und Ausdrucksweise anerkannt.
「Ausdruck」— Das Prinzip der Trennung von Idee und Ausdruck im japanischen Urheberrecht
Das dritte Erfordernis ist, dass das Werk in einer konkreten „Ausdruck“-Form vorliegt. Dies basiert auf dem grundlegenden Prinzip des Urheberrechts, der sogenannten „Trennung von Idee und Ausdruck“. Das bedeutet, dass das Gesetz nicht die Idee selbst schützt, sondern nur deren konkrete Ausdrucksform. Dieses Prinzip ist unerlässlich, um grundlegende Elemente wie Ideen, Fakten und Theorien als gemeinsames Gut der Gesellschaft frei nutzbar zu machen und so die kulturelle Entwicklung zu fördern. Das Ziel der „Förderung der kulturellen Entwicklung“, wie es in Artikel 1 des japanischen Urheberrechtsgesetzes festgelegt ist, wird durch dieses Prinzip gestützt.
Die klare Demonstration dieses Prinzips lieferte das Urteil des Obersten Gerichtshofs vom 28. Juni 2001 (2001) im „Esashi Oiwake-Fall“. In diesem Fall hatte ein Sachbuchautor ein Werk verfasst, das die Geschichte der Stadt Esashi in Hokkaido beschreibt, die einst durch den Heringfang florierte, dann verfiel und heute einmal im Jahr durch das nationale Festival des Volkslieds „Esashi Oiwake“ wiederbelebt wird. Ein Fernsehsender produzierte später ein Dokumentarprogramm mit genau derselben historischen Entwicklung und narrativen Struktur. Der Oberste Gerichtshof hob die Entscheidung der Vorinstanz auf und verneinte eine Urheberrechtsverletzung. Die Logik dahinter war eine strikte Trennung zwischen nicht geschützten Ideen und Fakten und dem geschützten Ausdruck. Es wurde entschieden, dass die historischen Fakten der Stadt und das narrative Gerüst (Plot) des „Aufstiegs → Niedergangs → Wiederauflebens“ als nicht geschützte „Ideen“ frei nutzbar sind. Andererseits wurde die spezifische Wortwahl und die metaphorische Ausdrucksweise, die der Autor zur Erzählung der Geschichte verwendete, als geschützter „Ausdruck“ angesehen. Da der Fernsehsender Ideen und Fakten nutzte, aber eigene Ausdrucksformen wie Narration und Bildmaterial verwendete, die nicht die „wesentlichen Merkmale des Ausdrucks“ des Originalwerks direkt erkennbar machten, wurde entschieden, dass keine Urheberrechtsverletzung vorlag.
Das Prinzip der Trennung von Idee und Ausdruck findet auch in anderen Bereichen breite Anwendung. So wurde beispielsweise im Urteil des Obersten Gerichtshofs für geistiges Eigentum vom 8. August 2012 (2012) im „Angel-Spiel-Fall“ entschieden, dass die Regeln und das System eines Spiels sowie die Reihenfolge der Bildschirmübergänge von „Titelbildschirm → Auswahl des Angelplatzes → Auswerfen → Fangbildschirm“ lediglich „Ideen“ für die Mechanik eines Angel-Spiels darstellen und nicht unter den Urheberrechtsschutz fallen. Geschützt wird nur der konkrete Ausdruck in Form von spezifischen Grafikdesigns, Charakteren, Musik und Text auf dem Bildschirm. Daher ist es schwierig, eine Urheberrechtsverletzung geltend zu machen, wenn ein Wettbewerber die Funktionen der eigenen Software nachahmt, solange der Quellcode nicht direkt kopiert wird. Denn nicht die Funktion als „Idee“, sondern der Quellcode als „Ausdruck“ ist geschützt.
“Der Bereich der Literatur, Wissenschaft, Kunst oder Musik” – Das Feld des geistigen Kulturguts
Die letzte Anforderung ist, dass das Werk dem “Bereich der Literatur, Wissenschaft, Kunst oder Musik” angehört. Diese Anforderung wird weit gefasst interpretiert, um die Früchte intellektueller und kultureller geistiger Aktivitäten einzuschließen, und normalerweise gibt es hier selten Probleme. Jedoch wird diese Anforderung zu einem wichtigen Streitpunkt im Bereich der “angewandten Kunst”, wo künstlerische Kreationen auf praktische Gegenstände angewendet werden.
Bei der angewandten Kunst geht es um die Abgrenzung zwischen dem Urheberrecht, das einen langfristigen Schutz gewährt, und dem Designrecht, das von einem kürzeren Schutz ausgeht. Die Gerichte tendieren dazu, vorsichtig zu urteilen, da ein zu weitreichender Schutz von Designs praktischer Massenprodukte durch das Urheberrecht die Rolle des Designrechts aushöhlen und die industrielle Tätigkeit übermäßig einschränken könnte.
Ein wichtiger Maßstab für diese Beurteilung wurde vom Obersten Gerichtshof für geistiges Eigentum am 8. Dezember 2021 (Reiwa 3) im “Tintenfischrutschen-Fall” gesetzt. In diesem Fall legte das Gericht fest, dass angewandte Kunst (ausgenommen Kunsthandwerk, das als Einzelstück hergestellt wird) als “Kunstwerk” im Sinne des Urheberrechts geschützt werden kann, wenn ihre ästhetischen Merkmale von der praktischen Funktion “getrennt” wahrgenommen werden können. Bei der in Frage stehenden Tintenfischrutsche entschied das Gericht, dass ihre Form untrennbar mit der Funktion als Spielgerät verbunden ist. Der Kopf des Tintenfischs stützt die Struktur und die Beine bilden die Rutsche selbst, sodass die ästhetischen und funktionalen Elemente integriert und nicht trennbar sind. Folglich wurde festgestellt, dass diese Rutsche kein Kunstwerk im Sinne des Urheberrechts darstellt.
Diese Entscheidung gibt Unternehmen wichtige Hinweise darauf, wie sie Produktdesigns schützen können. Wenn man das Design eines funktionalen Produkts als geistiges Eigentum schützen möchte, sollte man zunächst die Registrierung nach dem Designrecht in Betracht ziehen, da der Schutz durch das Urheberrecht begrenzt ist.
Andererseits ist ein Schutz durch das Urheberrecht möglich, wenn die ästhetische Ausdrucksform klar von der Funktion getrennt werden kann. Beispielsweise können Illustrationen auf T-Shirts oder Muster auf Bettwäsche als unabhängige Kunstwerke betrachtet werden, die unabhängig von der Funktion der praktischen Gegenstände – T-Shirts oder Bettwäsche – als Objekte ästhetischer Wertschätzung dienen und somit unter den Schutz des Urheberrechts fallen.
Die Grenzen zwischen urheberrechtlich geschützten Werken und nicht geschützten Werken unter japanischem Recht
Um die bisherige Diskussion zu ordnen, vergleichen wir anhand konkreter Gerichtsfälle die Grenzlinie zwischen dem urheberrechtlich geschützten “Ausdruck” und den nicht geschützten “Ideen” oder “Fakten”.
| Geschützt | Nicht geschützt | Zugehörige Gerichtsfälle |
|---|---|---|
| Konkrete Textausdrücke und Metaphern in Romanen | Handlungsstränge, Themen, historische Fakten von Romanen | Esashi Oiwake-Fall |
| Auswahl, Anordnung und Darstellungsweise von Informationen in Wohngebietkarten | Geografische Tatsachen an sich | Wohngebietkarten-Fall |
| Design der Spielscreens, Zeichnungen der Charaktere, Musik in Spielen | Spielregeln, Mechanismen, Reihenfolge der Bildschirmübergänge in Spielen | Angel-Spiel-Fall |
| Konkrete Quellcode-Beschreibungen von Computerprogrammen | Die vom Programm ausgeführten Algorithmen oder Funktionen | Urteil des Bezirksgerichts Osaka vom 29. Januar 2024 (2024) |
| Verkehrssicherheitsslogans mit originellem Ausdruck | Gewöhnliche, beschreibende Werbeslogans | Verkehrsslogan-Fall / Speed Learning-Fall |
| Auf T-Shirts gedruckte Illustrationen | Design von Spielgeräten, die mit ihrer Funktion verschmelzen | Oktopus-Rutsche-Fall |
Zusammenfassung
Die Definition von “Werk” im japanischen Urheberrecht ist nicht nur eine formale Checkliste, sondern ein tief durchdachter Standard, den die Gerichte in jedem Einzelfall anwenden. Die vier Anforderungen – Idee oder Gefühl, Kreativität, Ausdruck sowie der Bereich der Literatur, Wissenschaft, Kunst und Musik – stehen in Wechselwirkung miteinander, um die Rechte der Urheber zu schützen und gleichzeitig Ideen und Fakten als gemeinsames Gut der Gesellschaft zu sichern. Dies dient dem Ausgleich zwischen dem Schutz privater Interessen und dem öffentlichen Nutzen. Um das geistige Eigentum Ihres Unternehmens angemessen zu verwalten und das Risiko einer Verletzung der Rechte anderer zu vermeiden, ist es unerlässlich, diese Anforderungen und die Trends in der Rechtsprechung, die sie konkretisieren, tiefgehend zu verstehen.
Die Monolith Rechtsanwaltskanzlei hat eine umfangreiche Erfolgsbilanz in der Beratung und Unterstützung von Klienten aus verschiedenen Bereichen, wie Software, Content-Erstellung und Produktdesign, bei komplexen Fragen des japanischen Urheberrechts. Unsere Kanzlei beschäftigt mehrere Experten, die Englisch sprechen, einschließlich solcher mit ausländischen Anwaltszulassungen, was es uns ermöglicht, Unternehmen, die internationale Geschäfte betreiben, reibungslose und fachkundige Rechtsdienstleistungen bei urheberrechtlichen Herausforderungen zu bieten. Bitte zögern Sie nicht, sich mit Fragen zur Definition von Werken, wie in diesem Artikel erläutert, oder zur Entwicklung konkreter Strategien für geistiges Eigentum, an unsere Kanzlei zu wenden.
Category: General Corporate